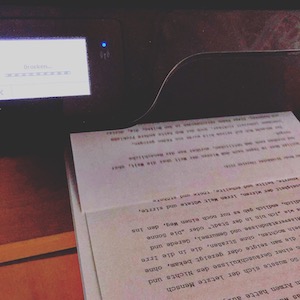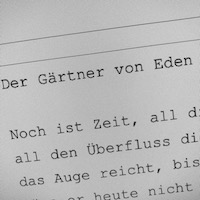Da liegt wieder einer dieser Romane, die man schon wegen ihres Umfangs als Epos bezeichnen muss: 1000 Seiten und mehr sind eine Hausnummer für sich. So begeistert ich mich ihnen auch zuwende, so abgeschreckt bin ich von ihnen. Ich kann mich auf kein einziges von ihnen freuen und freue mich dann letztlich doch über sie, wenn sie mir gefallen. Manchmal ärgern sie mich auch.
Das zeigt: Zu 1000-Seitern habe ich eine innige Hassliebe. Je nach Buch überwiegt das eine oder das andere. Diese Ambivalnz hat verschiedene Gründe.
Gerade die US-amerikanischen Autorinnen und Autoren haben vielen erzählen. Das sollte man ihnen im deutschen Literaturbetrieb oft neiden: Hierzulande ist man lieber karg unterwegs, einen Roman aus Deutschland von mehr als 400, sogar 500 Seiten bekommt man selten zu Gesicht.
In den USA hingegen kann man offenbar kaum genug von diesen dicken Werken bekommen.
Das hat zahlreiche beeindruckende Roman hervorgebracht, was man von Deutschland nicht behaupten kann.
In den USA herrscht Freude am Erzählen
In Amerika wird gerne mit beiden Händen in den Erzähltopf gegriffen und reichlich Wort auf überlebensgroße Leinwände geschleudert. Das ist eine Freude am Erzählen, die ich in deutschsprachigen Werken vermisse, und das fast ohne Ausnahme. In Amerika scheint man gern immer noch Neues, noch Weiteres hinzufügen zu wollen. Hierzulande hingegen ist man hauptsächlich damit beschäftigt, nicht absolut zwingende Worte zu streichen, um das Ganze so knapp wie möglich zu halten.
Nun liegt also wieder eines dieser US-amerikanischen Ungetüme auf meinem Tisch. Mehr als 1000 Seiten recht dünn bedruckte Fabulierkunst, nah am und im Leben, wundervoll, beeindruckend. Und es kommt wieder einmal, wie bei mir kommen muss:
1000 Seiten, auch die wundervollsten, haben für mich einen Haken. Sie binden mich wochenlang. Wer Bücher in sich hineinfrisst und 300 Seiten in einer Nacht und 1000 locker nach Feierabend in einer Woche inklusive Wochenende schafft, ist da mir gegenüber im Vorteil.
Ich bin für dieses Netflixen von Romanen nicht geschaffen. Dafür lese zu langsam und lege zu häufig das Buch an die Seite. 200 Seiten am Tag sind für mich zwar nichts Besonderes, aber alltäglich ist es für mich auch nicht.
Beschäftigung für Wochen
Damit wird ein derartiger Ziegelstein eines 1000-Seiten-Romans für mich eine Beschäftigung für Wochen. So gerne ich auch in diese Welten eintauche, fühle ich mich dabei jedoch zu sehr von einem Roman in Beschlag genommen. Und so sehr ich Erzählung, Geschichte und Sprache auch genießen mag, wird es mir zwischen Seite 300 und 400 für gewöhnlich zu viel. Ich mache dann eine Pause, um auch andere Dinge zu lesen: Sachbücher aus verschiedenen Themengebieten vor allem, aber manchmal mogelt sich auch ein kleiner, leichter Roman dazwischen.
Anschließend kann ich wieder entspannt und interessiert zum 1000-Seite zurückkehren und ihn mit Genuss zu Ende lesen.
Natürlich gibt es Ausreißer, sowohl zum Guten wie zum Schlechten.
Es gibt die 1000-Seiten-Schmöker, die ich nicht pausieren kann oder will. Das ist für mich jedes Mal ein Glücksfall, den ich sehr zu schätzen weiß.
Und es gibt die Monumentalbücher, bei denen ich mich schon ab Seite 100 langweile und bereits bei 50 Seiten weiß, dass wir keine Freunde werden. Das sind dann solche Bücher, in denen mir alles nur künstlich aufgeblasen scheint, um auf möglichst viel Umfang zu kommen. Sie lesen sich für mich zäh und interessieren mich schnell nicht mehr. Da fallen mir leider viele Bücher aus dem phantastischen Genre ein …
Der Distelfink von Donna Tart
Von meinem aktuellen 1000-Seiten-Wälzer kann ich das glücklicherweise nicht behaupten: „Der Distelfink“ von Donna Tart ist einfach wundervoll – obwohl ich mich erst einlesen musste. Sprachlich auf höchstem Niveau, erzählt es so literarisch wie unterhaltsam eine Geschichte, die mich begeistert und eine Story, die mich wirklich interessiert.
Die Pause zwischen Seite 300 und 400 schlug bei mir aber auch hier zu. Ich las drei Wochen mehrere Bücher über Sachthemen und eine japanische Novelle. Nun bin ich aber wieder bereit, in die Welt des Distelfinks zurückzukehren. Und wenn es läuft wie immer, lese ich es von nun an auch ohne weitere Unterbrechungen zu Ende.