Du sitzt da und schweigst, du hältst dein Glas vor dir fest und schaust verstohlen auf die Spiegelung deines Handys, während ich rede. Machst du es dir damit einfach? Oder bist du einfach nur sprachlos?
Stopp. Ich müsste mal die Klappe halten, Luft holen, einen Schluck trinken, mal sehen, was geschieht. Ich trinke, halte mein Glas weiter umfasst und warte. Auf Antwort. Auf Reaktion. Auf irgendwas.
Die Redepause nutzt du zu einem Schluck aus deinem Glas, und da kommt der Lärm von denen, die hier sitzen, stehen, trinken, essen, reden, lachen, kichern, diskutieren und schwatzen, lästern, schimpfen, sich anvertrauen, aufs Klo gehen, vom Klo zurückkehren, die Bedienungen bahnen sich ihren Weg wie tänzelnde Eisbrecher durch die Menschen, all das spritzt Gischt um uns, die wir zwei schweigende Felsen sind in einem Meer der Bewegung und des Lärms, während ich sitze und warte, während du nochmals einen Schluck aus deinem Glas nimmst. Du stellst dein Glas ab, während ich im Schwall der Worte um uns und warte.
Siehst du einem inneren Film zu? Oder starrst du einfach nur ins Nichts? Wir sind am Ende, habe ich gesagt. Es sei bedauerlich, aber verständlich, klar und in Ordnung so weit.
In Ordnung? Nichts ist in Ordnung! Aber ich kann das Rad nicht zurückdrehen, nichts wird ungeschehen sein, wie sehr ich es mir auch wünsche. Ich habe nun aufgehört zu kämpfen. Das Leben schmerzt nur solange, wie man es vergeblich zu ändern versucht. Wer aufhört, es ändern zu wollen, beginnt eine sanfte Reise auf dem Ozean der Ruhe und Stille mit dem Schiff namens Gelassenheit. Loslassen ist Befreiung.
Das Schweigen wird lang. Um uns trudelt die Welt durch ihre Bestimmung und hat mit uns nichts zu tun. Warum sagst du nichts?In meinen Därmen sprudelt die Quelle der Unruhe und im Gewirr meines Hirns beginnt das Verlangen nach Gewissheit zu sprudeln, ob ich Recht habe oder nicht.
Wir sind am Ende, habe ich gesagt. Stein für Stein hab ich die Mauer aufgebaut, um den Schmerz fern zu halten, und habe versucht, es mir dahinter gemütlich zu machen, doch nun stelle ich fest, dass ich mich durch dein Aussperren eingesperrt habe.
An einem der anderen Tische, drei Meter links von mir, in der heimeligen Ecke dort, sitzt eine junge Frau, die ebenso wartet wie ich. Der Stuhl ihr gegenüber ist leer, ihr Blick gleitet, ohne haften zu bleiben, ihre braunen Haare fallen in Locken über die Schultern, und trotz der Entfernung und des dämmrigen Lichts, das allen Kneipen zu eigen ist, da sie der Privatheit gedimmter Schummrigkeit bedürfen, trotz dieses Lichts also, das in seiner Gemütlichkeit heischenden Trübe die Farben aller Dinge in stimmungsvolles Grau zieht, erkenne ich Dutzende Sommersprossen auf ihren Wangen und Nasenflügeln. Mit großen braunen Augen betrachtet sie immer wieder ihr Handy auf dem Tisch in der Hoffnung, eine Nachricht möge kommen, die nicht kommt. Sie wartet wie ich im Stimmentosen. Sicher ist sie traurig. Ich denke mir, dass ihr bewusst ist, dass aus anfänglichem Wartenlassen, diesem Gewebe aus Langweile und Hoffnung, ein Sitzenbleiben geworden ist, eine Säure, die im Magen eines Riesen schwappt, der sie nun zu verdauen beginnt. Mit solch einem Ausgang kann sie nicht gerechnet haben, sonst wäre sie nicht hier. Hat mit Aufmerksamkeit gerechnet, sich Wichtigkeit gegeben, über die letztlich nur der Andere entscheidet – doch niemand kommt.
Ich sehe dich an und versuche zu deuten, was ich sehe. Die Tischplatte zwischen uns, auf der unsere Gläser stehen und unsere stummen Handys liegen, trennt Universen, wer hätte das gedacht!
Wir sind am Ende, habe ich gesagt, aber nur weil ich es sagte, muss ich es doch nicht wollen! Du warst mir nahe wie ein Zahn – lange Jahre ein Teil von mir, bis die Fäulnis einsetzte, warum auch immer, und nun bist du herausgerissen aus mir, die Wunde mag verheilen irgendwann, aber die Lücke wird immer bleiben.
Du schweigst, ich warte. Ich sehe dich an und wünsche mir, dein Blick ins Nirgendwo fände dort Antwort und Lösung, wünsche mir, dass du auf den großen Fang wartest, aber Hoffnung, was ist das schon, was ist es mehr als nur ein Wort, das nur Erlösung oder Vernichtung bringen kann, das uns im Dunkel unserer Wünsche und Neigungen tappen lässt, verstrickt im Außen, dem es Spaß macht, geliebt, begehrt, verehrt zu werden, dessen sadistische Befriedigung sich nur in Vorenthaltung oder Fortreißen zeigen kann, Hoffnung, diese Zersetzung, die mein Herz zerfrisst, denn ich will nur, dass du sagst, wie sehr ich im Unrecht bin, ich will, dass du mich dazu bringst, mich bei dir für meine Worte und Meinung entschuldigen zu müssen, sag was, ein Wort von mir aus nur, oder wenigstens zeig eine Geste, einen Blick, der mir zeigt, dass ich mich irre, bitte!
Themenblöcke werden zu Sand zerrieben, Jahre rieseln von uns herab. Wortlos blickst du blicklos durch den Tisch, auf dein Getränk, drehst versonnen dein Glas, und ich warte noch immer, auch wenn nun die Gewissheit Überhand gewinnt, dass alles gesagt worden ist.
Wir sind am Ende, habe ich gesagt, und habe das gesagt, was dir längst klar gewesen ist. Wir sind am Ende, habe ich gesagt, damit du es nicht zuerst sagen konntest, aber du hättest es nie gesagt. Nicht, weil du es nicht hättest wahrhaben wollen, sondern weil ich es längst hätte wissen müssen. Meine Worte waren ein Luftschnappen meiner Eitelkeit, die mich in der Illusion wiegen sollte, es wäre meine wohlüberlegte Entscheidung gewesen, das Wohlfühlprogramm in Zeiten des Unwohlseins, das nur mit Verblendung funktioniert.
Hinten in der Ecke trifft eine Frau ein, die sich zur Sommersprossigen setzt – das war es dann mit Sitzenlassen, das doch nur ein Wartenlassen war. Das war es dann mit Traurigkeit, die sich doch nur an meinem Tisch abspielt und die ich lieber dort drüben als bei mir gesehen hätte.
Nun bin ich da, wohin ich gehöre: am Ende meiner Einbildungen.
Du schweigst, aber dein Schweigen sagt alles. Es ist egal, ob du nichts zu sagen weißt oder nichts mehr zu sagen hast. Die Tischplatte zwischen uns hackt uns in zwei Regionen, da erscheint die Welt in Regenbogenfarben. In den Prismen meiner Tränen offenbart sich gar das Licht als Täuschung der Sinne, die es uns bequem machen, die uns eine Welt zeigen, die so gar nicht ist, und nur in Momenten wie diesen erkennen wir es.
Wir sind am Ende, habe ich sagt und habe es nicht so gemeint. Ich wollte, dass du es mir ausredest, dass du wütend oder traurig oder sonst was bist, aber dass du wortlos da sitzt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, wie es hätte werden können, aber die Möglichkeit einer Möglichkeit wäre tröstlich gewesen. Ein Ende wie nun ist eine Sackgasse. Sie erzwingt Umkehr und Rückzug.
Wortlos ertaste ich Geld, viel zu viel, und lege es auf den Tisch. In mir ist Beklemmung, die den Verlustschmerz gebiert. Das Ende dieses Weges mündet in das Ende aller Worte. Das Schweigen der Worte ist ein Schweigen der Zukunft.
So gehe ich, während du weiter schweigst und sich dein Blick in den Spiegelungen deines Handys verliert.






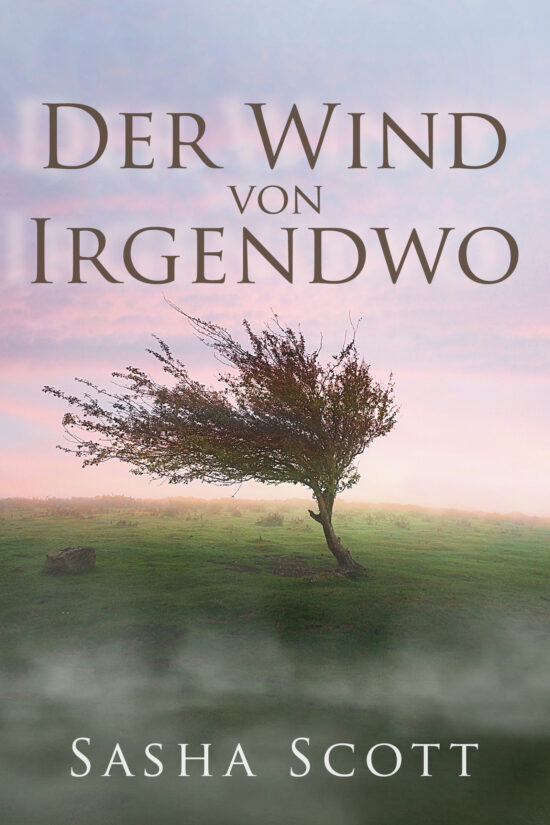
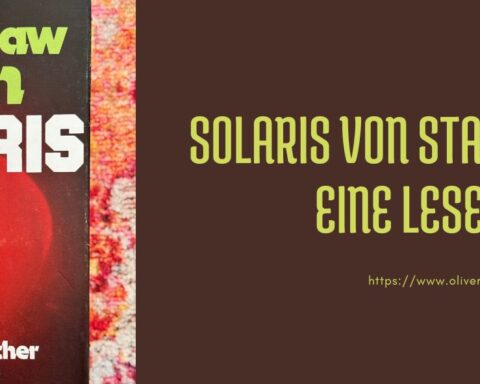


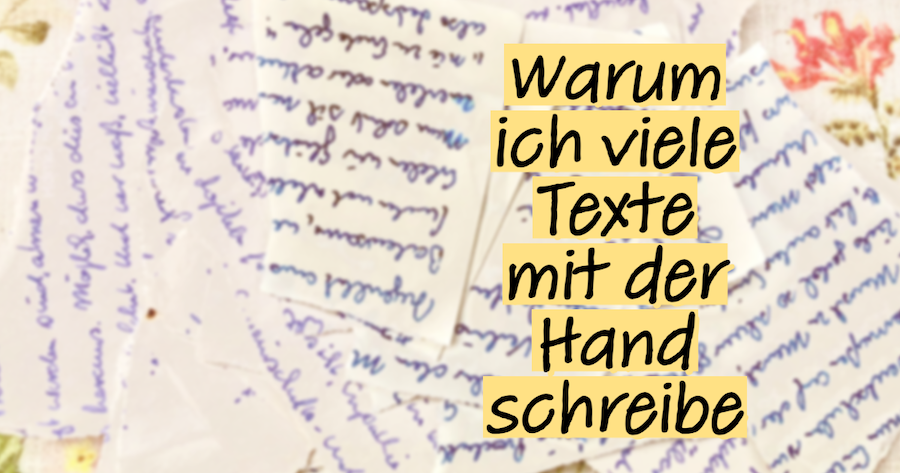
[…] Story »Im Schweigen« machte letzte Woche den Anfang – da kommt nun mehr:In loser Reihenfolge stelle ich künftig […]