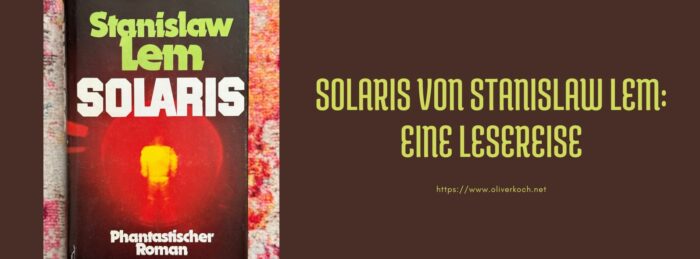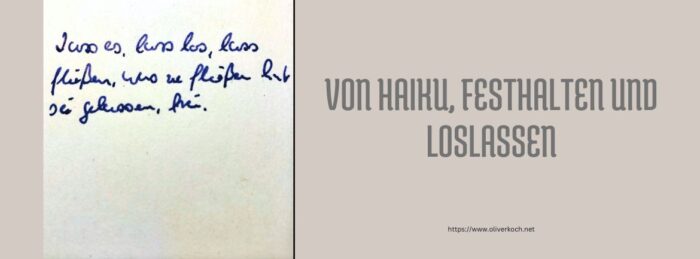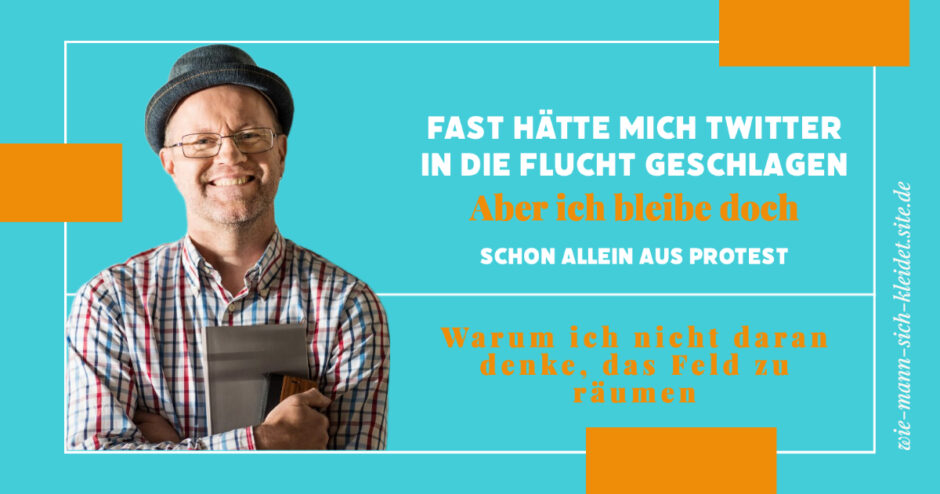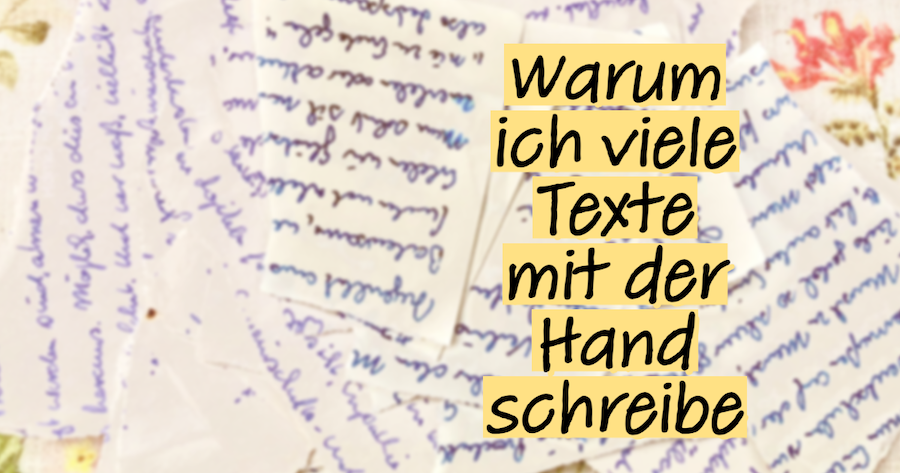Tinte spiegelt sich im Tintenfass. Ein Anblick, der selten geworden ist. Und deshalb so besonders wie wertvoll. Denn es gibt sie noch, die Tintenfässer und mit ihnen die Tinte, in der sich das Licht des Umgebung spiegelt. In breiten Kreisen ist all das unbekannt geworden. Wer schreibt noch mit der Hand? Wer mit Tinte? Wer mit Füllern, die man eigenhändig befüllen muss, anstatt ihnen wenigstens eine schnelllebige Patrone einzusetzen?
Auch ich bin so aufgewachsen, damals in den 70ern und 80ern. Allenfalls ging es um die Frage: Pelikan oder Geha? Ich war Team Geha – der Aura wegen, die ich darum sah. Man konnte angebotene Pelikan-Patronen ablehnen, die es zuhauf in der Klasse gab und sagen, dass sie leider nicht passten. Man fühlte sich dadurch auf grundschulartige Weise erhöht. Tja.
Sagen wir ruhig Magie dazu
Sehr wahrscheinlich, dass ich all das auch deshalb mochte, weil ich schon damals das Besondere suchte – das, wie ich zugeben muss und überhaupt jeder zugeben muss, der so denkt und lebt und handelt – auch anstrengend ist, mindestens aber herausfordernd. Es sich immer einfach einfach machen, war nie das, was ich gesucht habe, denn das hielt ich für profan, was nicht zu dem passte, was ich schon damals suchte. Ich war und bin ein Suchender von Erfahrungen, Wissen und Dingen jenseits des Profanen, weil ich glaube, eine Wahrheit dort zu finden, die ich sonst nicht fände.
Tinte im Tintenfass kam erst spät in mein Leben. Dann aber mit Liebe. Es ist mehr als eine mondäne Form, überhaupt spielt Mondänes hier keine Rolle. Vielmehr ist es eine bewusste Form, eine, die Achtung und Respekt erfordert vor so vielen Dingen: der Tinte, dem Schreibgerät, dem, was zu schreiben ist, überhaupt dem Akt des Schreibens mit all seinen zahllosen Einzelheiten, in die man es aufdröseln könnte, aber nicht muss. Denn wie Rilke sagt „ihr macht mir all die Dinge tot“, wenn man sich – wie derzeit Mode – ins Unendliche definiert, nur um hinter all den Definitionen unendliche Langeweile und Leere zu erleiden und die Sehnsucht nach Fülle und Bedeutung zu erleben, die man man in Erfahrungen, Wissen und Dingen finden kann, wenn man offen und neugierig genug ist. Sagen wir ruhig Magie dazu.
Handgriffe so schützenswert wie aussterbende Sprachen
Ein Tintenfass bringt also Magie in mein Leben. Dutzende kleine Handgriffe, die selten geworden sind und deshalb so schützenswert wie aussterbende Sprachen. Was Tintenfässer bieten: rahmensprengende Vielfalt an Farben, Pigmenten, Verarbeitungen, Auswahl. Eine ganze aufeinander abgestimmte Welt existiert da, und zu ihr gehört eine enorme Vielzahl an Schreibgeräten wie Füllern, aber auch Schreibfedern, Papieren.
Es zeigt, dass eines nur ein Teil eines Größeren ist, und dass es hier nicht nur um ein Tintenfass geht. Gäbe es keine Tintenfässer mehr, verlöre die Menschheit eine Menge anderer Schönheiten, Besonderheiten, Fertigkeiten gleich mit – was sich zu einem Verlust weit größeren Maßstabs summierte, ließe man all das einfach vergehen.
Natürlich ist dies Liebhaberei ohne Anspruch darauf, gegenwärtige Techniken abzulösen. Tintenfässer sind, wie der gesamte sie umgebene Schreibkosmos aus Federn, Füllern, Papier und Freude am Handschriftlichen oder gar der Kalligrafie eine Nische geworden, auch ein Relikt. Die Verfahren und Dinge, die diesen Kosmos in der Allgemeinheit ablösten, entstanden aus logischen Entwicklungen und haben somit ihr Gutes.
Menschen mit Hang zu Ästhetik, Schönheit, Handwerk
Zudem: Jahrhunderte, wenn nicht mehr als ein Jahrtausend lang gehörte auch diese mit all ihren Schönheiten und Feinheiten zum Tätigkeitsfeld einer kleinen Gruppe – und sie ist es, wenn auch unter anderen Bedingungen, auch heute wieder. Konnte für so lange Zeit die Mehrheit der Menschen nicht einmal schreiben, so ist sie heute des Schreibens wenigstens fähig, wenn auch mit anderen Verfahren und Geräten wie Tinte und Füller.
Heute sind es die Menschen mit Hang zu Ästhetik, Schönheit, Handwerk, die zu Tinte und Feder greifen. Vielleicht ist diese Gruppe Mensch größer als die Gesamtheit derer, die über viele Jahrhunderte überhaupt nicht schreiben konnte. Wer weiß.
Heute jedenfalls ist es eine Fertigkeit, die man pflegt, der man sich mit voller Bewusstheit, Muße und Liebe widmet. Gut so.
Ich fühle mich also gut dabei, ins Tintenfässchen zu blicken, die Spiegelungen zu sehen und zu wissen, wie selten dieser Anblick doch ist. Künftig werde ich genauer hinschauen, wenn ich eine meiner Schreibfedern in Tinte tunke, ob blau, ob grün, ob rot. Es gibt also auch künftig einiges zu entdecken. Ich bleibe neugierig.