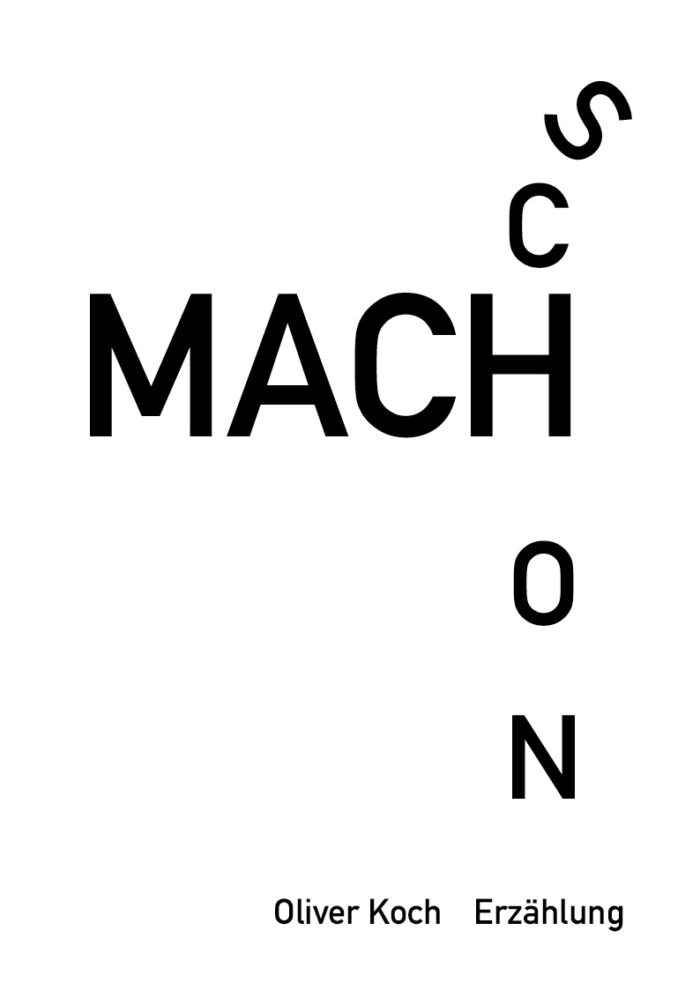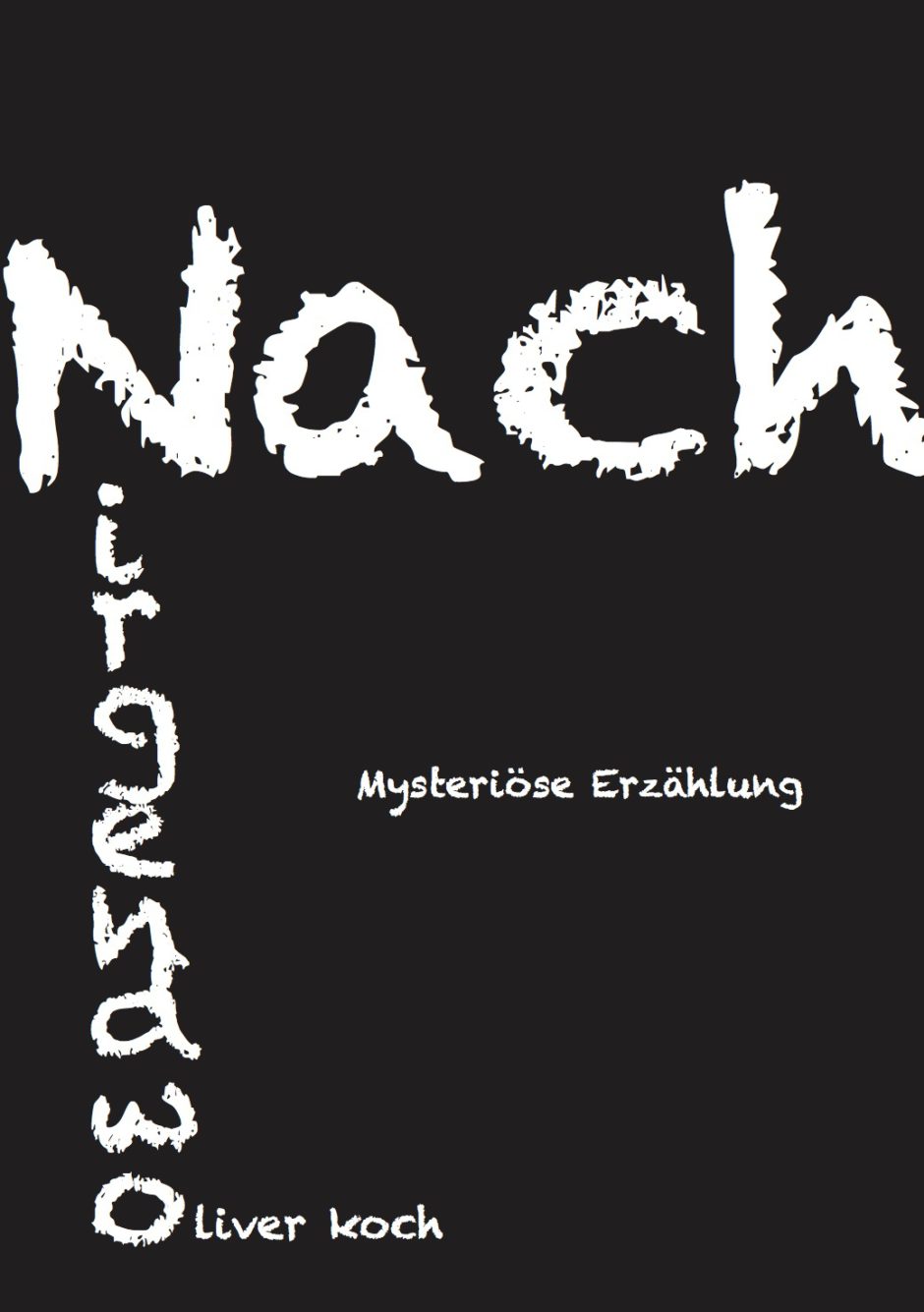Da liegt vor ihnen und man weiß nicht weiter. Die Schneise in der Gartenerde, die es geschlagen hat, die ist offensichtlich: Erst hat es sich bei Eintritt schräg vom Himmel in die Gemüseparzellen gebohrt und ab dort eine Furche geschlagen, zu deren Rändern sich die Erde auftürmt. Je weiter es sich in Richtung Rasenfläche vorgearbeitet hat, hat es sich weiter in die Tiefe gebohrt, sodass die Furche tiefer und die Ränder höher werden. Erdklumpen rieseln herab, überall liegen Pflanzenreste, es sieht aus, als wolle jemand ein Rohr verlegen. Die drapierte Buschgruppe hat es zerlegt, es ist fraglich, ob das einst so hübsche Arrangement, das sorgsam ausgesucht das ganze Jahr über blüht und im Winter mit Immergrün erfreut, den wüsten Schneisenschlag überleben wird. Derzeit sieht es nicht danach aus. Möglich, dass die äußersten Triebe sich noch retten lassen, sorgsam getrennt, liebevoll in Erholung gepflegt – wer weiß.
Ja, all das, was sie hier sehen, ist irgendwie klar, auch wenn es an sich unfassbar ist, wie etwas aus heiterem Himmel – im wahrsten Wortsinn – kometenhaft in spitzem Winkel in den Garten eintreten konnte. Überdies hat es beim Sturz den Zaun ruiniert. Wie den eine Versicherung ersetzen soll, ist fraglich, denn da stehen sie, alle anwesenden Parteien des Hauses, in dessen Garten nun die Schneise schneist, und sie starren auf das, was bis zur Terrasse durchgedrungen ist, dass es die ersten Bodenplatten anhebt.
„Ähm“, sagt M. Er sagt es nun zum dritten oder vierten Mal. Aber mehr fällt ihm nicht ein.
„Ja“, pflichtet S. von der Etage drunter bei. „Das ist wirklich … ähm.“
„Sauerei“, zischt R, der im Parterre wohnt und das Haus so lange kennt wie niemand sonst. R. begrüßte alle bei ihren Einzügen und hat schon manchen beim Auszug verabschiedet. R. ist es auch, der gerade im Frühjahr für neue Bodenplatten auf seiner Terrasse gesorgt hat, die neben der Terrasse für die Allgemeinheit von einer stirnhohen Hecke umgeben ist, damit er blickdicht seine Ruhe hat. „Das ist eine Sauerei. Für so was haben die Geld. Und dann fällt es ihnen auch noch runter in unsere Gärten. Sauerei.“
Im Gegensatz zu L. und T. hat Frau W. noch kein Wort gesagt. Ihr ist das alles einfach zu viel, und so sagt sie nichts. Denken übrigens auch nichts. Sie steht einfach da, reines Betrachten – oder möchte man Gaffen sagen – völlig ohne Staunen und Wundern, sondern einfach nur bloßer Blick, der die Schneise bis zum Endpunkt verfolgt, immer und immer wieder.
„Ähm“, sagt M. schon wieder. „Was soll denn das sein?“
Es ist nicht das erste Mal, das diese Frage gestellt wird. Vielmehr wird sie weiter gereicht oder reicht sich selbst weiter von Mund zu Mund, und wen soll es wundern, denn schließlich ist dies das einzig Logische, das dazu gesagt werden kann.
Da liegt es vor ihnen und man weiß nicht weiter. Wenigstens um die Ausmaße gibt es keine Unklarheit. Größer als einen Meter ist es keinesfalls. M. schätzt es eher kleiner. 80 Zentimeter vielleicht.
Doch ob es rund ist oder eckig, da hört es dann schon auf. Ob das ovale Teil, das sich in den Boden gebohrt hat, nun die Spitze oder das Ende, eine Seite oder das Oben oder Unten sein mag, weiß schon wieder niemand. Überhaupt, diese Form.
„Keine Ahnung“, erwidert L., ebenfalls nicht zum ersten Mal. „Echt. Echt keine Ahnung.“
„Tja.“
L. geht in die Hocke, so weit, dass seine Knie die Erde berühren, die sich am Rand der Schneise aufgetürmt hat, und seine Frau holt zischend Luft und fährt ihren rechten Arm zu seiner Schulter aus, doch es ist zu spät, da hockt er schon und reckt den Kopf. „Tja. Ein Satellit vielleicht?“
„Glaub ich nicht. Wo soll denn ein Satellit herkommen?“
„Von oben. Von wo denn sonst?“
Dass ausgerechnet nun Max heimkommt, ist eher unpassend. Er war mit Freunden Gott weiß wo und ist normalerweise den Tag über nicht da, aber ausgerechnet jetzt kommt er doch heim und ist allein. „Was machst du denn hier?“ fragt seine Mutter verstört, und er schaut sie an und gibt zurück „Sorry, ich wohne hier?“ Dann blickt er auf das, worauf alle starren. „Was ist das denn?“
„Ähm“ sagt M.
Und ja: Was ist es nur?
Das beginnt nicht nur mit der Form und Größe, sondern auch mit der Farbe. „Irgendwie grau?“ hat L. eben gefragt, und obwohl jeder aus der Hausgemeinschaft „irgendwie schon“ formuliert hat, sträubt sich dagegen die Erkenntnis, denn es ist gleichzeitig ein „irgendwie nein“. Grau: Was heißt das schon? Ein wie auch immer geartetes Dazwischen von Weiß und Schwarz, eine Schattierung dieser Mischung beider Töne ist nicht erkennbar. Denn da ist keine Schattierung zu erkennen, keine Ahnung von Schwarz, keine Andeutung von Weiß. Überhaupt ein Farbton – ist da einer? Niemand weiß es, L. nicht, wie auch die anderen nicht. Im Gegenlicht, je nach Blickwinkel, macht es den Anschein, als reflektiere es die Sonne, andererseits auch wieder nicht. Nein, es glänzt nicht. Und weil es nicht glänzt, reflektiert es auch das Sonnenlicht nicht. Andererseits hat es je nach Sonneneinfall und Blickwinkel hellere und dunklere Partien.
M. hat weder Begriff noch Vorstellung dafür außer einer Sache: Er hat dergleichen noch nie gesehen und sich nie vorgestellt. Was er sicher weiß ist, dass es seinen Garten ruiniert hat, und so bricht sein Blick immer von der Unbekanntheit vor ihm ab in den Garten, den er pflegt, den er plant, den er umsorgt. Er zahlt mehr Geld als alle für die Nutzung dieses Raums, den Rasen, die Beete, und die Tomaten, die dort wachsen und die noch neben der Schneise im Sonnenlicht leuchten, erst gestern hat er einige von ihnen im selbst gemachten Salat verputzt. Dieses Ding, was immer es sein mag und wo immer es auch herkommen mag, hat seinen Garten ruiniert, so viel steht fest. Fest steht auch, dass es nicht damit getan ist, die Zerstörung zu fotografieren – er wird das Chaos so lange bestehen lassen müssen, bis Sachverständige da gewesen sind, Polizei ganz sicher, aber auch Versicherungsmenschen, die prüfen müssen, ob und in wie weit sie für den entstandenen Schaden geradestehen werden. Ärgerlich.
Niemand hat mitbekommen, dass sich Max auf den Boden gelegt hat und mit dem Oberkörper nah über dem Ding schwebt. Seine Mutter ruft „Max“, doch es ist zu spät. Er reckt seine Hand danach aus. „Mach dir nicht ins Hemd“, sagt er, ohne den Blick von dem Ding zu nehmen, „ich fass es nicht sofort an, ich bin doch nicht bescheuert.“
M. mag Max. Ihm gefällt diese Rotzigkeit, mit der der Junge mit seinen 16 Jahren auftritt.
Jeder hält den Atem an, während Max Hand kurz über dem Ding schwebt. „Also heiß scheint es nicht zu sein“, meint der Junge. Er streckt den Zeigefinger aus, und jeder spürt, dass Max fast das Herz stehen bleibt, doch er kann nicht anders: Trotz aller eigener Bedenken tippt er daran, nur für den Bruchteil einer Sekunde. „Ne. Ist nicht warm.“
„Pass wegen der Radioaktivität auf“, stöhnt seine Mutter durch die Hände, die sie vor ihren Mund geschlagen hat.
M. schaut sie verstört an. „Wieso Radioaktivität?“
„Naja“, beginnt sie, ihre Hände noch immer vor den Mund gepresst, die Augen tellergroß, „sind diese Dinger nicht immer radioaktiv?“
„Wieso sollten sie das sein?“
„Naja. Es kommt ja von …“
Der Rest ist Schweigen.
Frau W. schreitet die Schneise ab und ist inzwischen an den Gemüsebeeten angelangt. Sie sucht zwar nichts, aber sie schaut trotzdem über das, was ihr Nachbar M. so züchtet und sich regelmäßig in die Töpfe und Salatschüsseln schnippelt.
Max pult in der Erde, die auf das Ding rieselt ohne Geräusch. Nichts deutet darauf hin, dass das Ding sich tiefer in die Erde gebohrt hat und damit einen Teil von sich verbirgt. „Komisch, hat keine Delle oder so.“
„Ja, es sieht unbeschädigt aus“, meint M.
„Aber aus was ist es dann gemacht?“
Metall ist es nicht, und wenn, dann eines, das noch niemand gesehen hat. Und überhaupt: Das Material ist jedem fremd.
„Ähm“, sagt diesmal L, der noch immer kniet und sich der Hand seiner Frau auf seiner linken Schulter sicher weiß.
„Was ist denn da bei Ihnen passiert?“ ruft es da von jenseits des Zauns, und als sie sich alle umdrehen, bemerken sie die zahllosen Gesichter, die über Zäune und aus Fenstern und von Balkonen rund um das Grundstück zu ihnen und ihrer Misere herüberschauen.
„Etwas ist abgestürzt“, ruft L. pflichtschuldig, so laut es geht, „wir wissen auch nicht, was es ist!“
„Um Gottes Willen, jemand muss die Polizei rufen!“
„Eine Bombe! Eine Bombe! Passen Sie bloß auf!“
Sie wenden sich wieder dem Ding in der Erde zu, das Max, der noch immer auf dem Boden liegt, inzwischen mit beiden Händen berührt. Fasziniert streicht er darüber, betrachtet es, und es scheint, als habe es ihn ganz in den Bann geschlagen. „Max, nicht!“ ruft seine Mutter ungehört, und Max stellt fest, dass er keine Ahnung hat, wie es sich anfühlt, was da vor ihm liegt. „Nicht warm, nicht kalt. Nix.“
„Wie, nix?“, will M. wissen und bückt sich seinerseits, um es zu berühren. Die anderen Gesichter recken sich synchron herab und sehen M.’s Händen bei der Berührung zu.
„Er hat recht“, meint M. „Nix.“
„Was soll das heißen? Wie fühlt es sich an?“
„Das ist es ja: Es fühlt sich gar nicht an.“
Jedes Material bietet ein Gefühl, doch dieses hier sendet Signale ins Leere. M. weiß nur, Derartiges nie gefühlt zu haben.
Ungläubig streicht er über die Fläche, und es gibt keinen Ton der Reibung. Er spürt keine Kante, keine Unebenheit, aber auch nichts, was auf eine gänzlich glatte Oberfläche hindeutet. Er spürt nur Fremdheit.
„Hm.“
„Ja hallo, ich möchte den Absturz eines Dings melden.“
Alles dreht sich um, denn die Stimme gehört zu Frau W., die mit der Polizei telefoniert. Sie steht ein wenig abseits, ihr linker Arm um den Oberkörper geschlungen, ihr Telefon am rechten Ohr, und ohne jede Regung schaut sie in Richtung Ding, ohne es anzusehen. „Wir wissen es nicht. Es ist vom Himmel gefallen. Ja, runter. Natürlich runter, es kam ja vom Himmel. Es hat den Garten verwüstet. Nein, ich kann Ihnen nicht sagen … – kommen Sie doch her und sehen es sich selbst an. Nein, ich kann es nicht beschreiben, nein. … – warten Sie.“ Sie schaut in die Runde. „Die wollen wissen, was es ist.“
„Sollen sie es sich doch selbst ansehen“, grollt M. „Woher sollen wir das denn wissen?“
Frau W. spricht weiter: „Maschine? Keine Ahnung. Nein, ich kann nicht beschreiben, wie es aussieht. Bombe? Moment.“ Sie sieht sie an: „Kann es eine Bombe sein?“
Niemand hat bislang von ihnen eine Bombe leibhaftig gesehen. Aber niemand kann sich eine Bombe wie diese vorstellen.
Frau W. schürzt die Lippen. „Eher nicht. Warum kommen Sie nicht selbst, dann sehen Sie es doch? Warten Sie.“ Sie fragt wieder in die Runde: „Er will das Material wissen. Ob es ein Meteorit oder ein Ding ist.“
„Was unterscheidet denn einen Meteoriten von einem Ding?“, kläfft L. „Keine Ahnung. Sieht nicht nach einem Stein aus. Oder?“
Max und M. befühlen das Fremde weiter und finden nicht, dass es aus Stein ist. Oder Holz. Aus Plastik aber auch nicht.
„Sie kommen nicht“, sagt Frau W. „Sie halten es für einen Scherz. Sie meinen, sie können nicht kommen, wenn nichts passiert ist.“
L.’s Frau wedelt mit beiden Händen in Richtung Ding. „Ist da etwa nichts passiert?“ Sie weist weit ausholend auf die Schneise im Garten. „Ist DAS etwa nicht passiert? Was wollen die denn noch?“
„Er meinte, verarschen kann er sich selber.“
„Ich glaub’s nicht! Muss die Polizei nicht kommen, wenn man sie ruft?“
„Er meint, wir müssten angeben können, was passiert ist.“
„Ich fass es nicht.“
„Ja aber …“ M. richtet sich wieder auf. „Was ist denn passiert, frage ich Sie? Was können wir sagen, was passiert ist? Da ist dieses … – dieses … ähm …“
„Es ist vom Himmel in unseren Garten gekracht!“ empört sich L.
„In meinen Garten“, sagt M. „Es ist mein Garten.“
„Oh, ich bitte um Verzeihung, dürfen wir weiter in Ihrem Garten stehen und Anteil nehmen? Also wirklich! Immerhin liegt es direkt an UNSEREM Haus und UNSEREN Wohnungen!“
„Ja aber er hat recht“, sagt L.’s Frau. „Was ist passiert? Was ist das da?“
Alle Blicke wandern wieder auf das fremde Ding ohne Nähte, ohne Ösen und Schrauben, ohne jeden erkennbaren Hinweis darauf, gemacht zu sein.
Da reißt Frau W. ihre Augen auf, lässt das Telefon in den Rasen fallen und springt mit vor dem Mund zusammengeschlagenen Händen entsetzt zurück. „Oh Gott!“
Kaum liegen die Worte in der Luft, ergreift jeden die Panik, denn jedem ist nun klar, auf was Frau W. zu sprechen kommen will. Auch wenn niemand recht daran selbst gedacht hat, steht nun eine Möglichkeit im Raum, die der Instinkt jedem von ihnen in den Geist gelegt hat.
„Es LEBT!“ ruft sie aus, und jeder weicht zurück. Max ist schneller auf den Beinen, als irgend jemand sehen kann, und M. wird schlagartig heiß. Da krabbelt etwas seine Hände hinauf, mit denen er eben noch das Ding berührt hat, ein scheußliches Kribbeln, als werde sein Körper geentert.
Es ist, als habe jemand alle Atemluft aus der Welt gesogen, und voller Grauen starren sie alle auf das Ding da, das … – vielleicht LEBT?
Wie lange sie starren und schweigen, wissen sie nicht, als Max die Stille durchbricht: „Also wenn das so ist, dann ist es jetzt sicher tot.“
M. kann wieder Sauerstoff in seine Lunge ziehen.
„Naja, das überlebt doch keiner“, schließt Max. „Fallt ihr mal vom Himmel und kracht in den Garten. Das will ich sehen, was das überlebt.“
„Und wenn es ein Panzer ist wie bei einer Schildkröte?“
Sie nähern sich schrittweise und beugen sich zaghaft herab.
„Ne, glaub ich nicht“, meint L. „Kann aber sein. Ach, was weiß denn ich.“
„Okay“, sagt M. da. „Das wird mir jetzt zu blöd. Lassen wir es einfach liegen.“
Alle Augen richten sich auf ihn, und er blickt in die Runde. „Ja, ich meine es ernst. Was sollen wir denn den Leuten erzählen? Ich hab keine Ahnung, was das ist, oder geht es einem etwa anders?“
Verstohlene Blicke sind die Antwort. „Na also. Wir wissen alle nicht, was das da ist, was das da soll und woher es kommt. Also ich hab echt keine Idee.“
„Wir sollen also einfach so tun, als wäre es nicht da?“
„Was heißt, so tun? Da ist nichts! Nichts, was wir benennen können. Nichts, wovon wir eine Vorstellung haben. Für mich ist das quasi gar nichts.“
L. schürzt die Lippen. „Da hat er recht.“
„Stimmt“, pflichtet seine Frau ihm bei.
Max, der wieder auf dem Boden liegt und seine Hände mit größerer Vorsicht als zuvor über die Oberfläche gleiten lässt, gibt ein kurzes „Hm“ von sich. Während er das Ding so untersucht, wird ihm klar: „Die Leute würden das auch für einen Fake halten.“
„Einen was?“ Frau W. ist irritiert.
„Eine Fälschung. Wenn ich das fotografiere und teile, denkt jeder, ich mach nen Witz. Das glaubt einfach keiner.“
„Und wer soll so eine Schneise aus Jux in einen Garten buddeln?“
„Geht auch als Fake durch. Und es gibt echt viele, die notfalls buddeln, um was zum Erzählen zu haben.“
Sie schauen herab, hinter ihnen verschwinden die ersten Zuschauer und wenden sich ab. Grillgeruch weht herüber, die Stille der Umgebung weicht.
„Deshalb sag ich ja“, meint M. „lasst es uns einfach zuschütten. In ein paar Wochen ist wieder Gras über die Sache gewachsen und kein Hahn kräht mehr danach.“
„Und wenn es doch lebt?“, fragt S. besorgt. „Unsere Terrasse ist doch direkt daneben …“ Der Gedanke, dass dort jemand oder etwas nächtens plötzlich vor seiner Terrassentür stehen mag, behagt ihm gar nicht. „Nachher wächst das noch zu einer echten Krise aus!“
Max zuckt die Achseln. „Also wie gesagt: Nix überlebt das.“
M.’s Blick wandert zu seinen Gemüsebeeten. Das Chaos, die abgeknickten Äste, die halb herausgerissenen Pflanzen tun ihm fast körperlich weh, und die Sehnsucht überfällt ihn, sie zu richten. Dass da Tomaten und Gurken auf der Erde liegen, stört ihn, er möchte nicht, dass sie faulen. „Also. Es ist meiner Meinung nach nichts passiert. Sieht es jemand anders?“
Niemand sagt etwas. Mit jedem Schwung Erde, der das Ding im Boden kurze Zeit später verdeckt, kehrt Frieden ein. S. verbuddelt es nahezu im Alleingang, Max kommt mit seiner Schaufel kaum hinterher. M. sortiert seinen Gemüsegarten, und von jenseits des Zauns nimmt man nur wahr, dass dort Ordnung einkehrt. Sicher, die Büsche sind größtenteils hin, und bis diese Bresche vollends zugeschüttet ist, werden Tage vergehen. Ganz zu schweigen von der Zeit, die es braucht, bis das neue Gras gewachsen ist.
Aber ihm dabei zuzusehen, wie es täglich mehr wird, ist doch ein schönes Gefühl.
Erzählung „Sag mir, wer du bist“
Laura war klar, dass die Nachbarn reden, und auch wenn sie bedeutendere Probleme hatte, war es ihr unangenehm. Sie dachte daran, während sie im Zimmer ihres Sohnes saß und weinte. Sie dachte daran, als sie das erste Mal aus der Tür trat, nachdem es bekannt geworden war und sie den Blick der Leute hatte aushalten müssen. Viele von ihnen kannte sie gar nicht oder nur vom Sehen, wie Sternschnuppen waren sie zuvor aufgetaucht und wieder aus ihrem Blickfeld verschwunden, fortgeschwemmt mit ihren Ansichten, die belanglos für sie gewesen sind, wie umgekehrt auch sie nichts anderes für diese Nachbarn gewesen ist als eine Erscheinung, die zufällig den Weg kreuzte.
Bis vor drei Tagen. Als sie danach das erste Mal das Haus verlassen musste, spürte sie, wie sie zu einem Blickpunkt geworden war, der bewertet und verachtet wurde.
Dabei konnte sie unmöglich die Schuld tragen – zumindest nicht allein. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie es hatte geschehen können, und so unbeteiligt sie sich fühlte, so ungerecht empfand sie zu allem Gram die Abwertung ihrer Nachbarn.
Ob alle Freunde noch zu ihr hielten, die sich bislang nicht gemeldet hatten?
Monika hatte keine Stunde nach der Mitteilung bei ihr angerufen, um ihr zu versichern, dass sie zu ihr halten werde „egal, was passiert ist“.
Wenigstens. Aber dieses „Egal“ war und blieb das Kainsmal. Denn was geschehen war, war nicht egal, und es ließ sich nicht mehr aus der Welt schaffen.
Seit drei Tagen bekam sie kein Auge zu, und die Stille zwischen all den Gesprächen und Telefonaten spendete Trost und Schmerz gleichermaßen.
Die Stille ließ sie eintreten in das Reich der Bewertung, und dieses Reich war gewaltig. Es hatte unerforschte Gelände wie ausgetretene Pfade, es hatte Klippen und Tiefen, stille Wasser und stürmische Steppen. Hin- und hergerissen zwischen Ohnmacht, Scham und Schuld fand Laura noch nicht den Platz, an dem sie sich niederlassen konnte – stattdessen trieb sie durch dieses Reich und marterte sich mit den unendlichen Möglichkeiten, die es bot.
Sie war zu betäubt, um müde zu sein, und auch zu betäubt, das Zimmer, in dem sie gerade saß, mit ihrem Sohn in Verbindung zu bringen, obwohl es seines war.
Das Zimmer eines Teenagers, auf rührende Weise chaotisch, auch wenn sie immer sagte, er solle aufräumen. Poster hingen da ebenso wie erste Bilder von Renoir – billige Pappdrucke in rahmenlosen Bilderhaltern, aber für ihn war es wie ein Museum und ein Schritt zum Erwachsenwerden. Renoir hatte er in einer Zeitschrift beim Arzt entdeckt, sich eine kleine Kollektion besorgt und zwischen Film- und Bandplakaten sowie einem Fan-T-Shirt an die Wand gehängt.
In diesem Zimmer machte er seine Hausaufgaben oder täuschte es wenigstens vor. Den Flachbildmonitor des Computers hatte er sich vor drei Monaten durch einen Ferienjob verdient, und er war so froh, als er ihn sich gekauft und aufgestellt hatte. „Wow“ war durch das Haus gehallt, voller Glück über dieses alberne Technik-Ding. „Superscharfes Bild!“
Und nun saß sie da und atmete die Luft eines seit drei Tagen ungelüfteten Zimmers ein, das noch ein wenig nach ihrem Sohn roch. Seinem Deo aus de mSupermarkt, das er sich unter die Achseln sprühte. Und fragt sich, was die Nachbarn wohl dachten. Ob sie letztlich fair seien – aber konnte sie das erwarten? Die Zeitungen fragten, wie es hatte geschehen können, und was sollte sie darauf sagen?
„Ich habe keine Ahnung“, sagte sie jedem und immer wieder sich selbst „Er war ein ganz normales Kind.“
„Er hat keine Auffälligkeiten gezeigt“, hatte der Schulleiter zu Protokoll gegeben, vor zwei Tagen, als die Schule plötzlich still stand. Seitdem spudelten die Ermittlungen mehr und mehr gruselige Details aus.
Warum ihr Sohn zum Mörder wurde, wusste noch niemand – doch die Nachbarn sagten nun, sie habe es verschuldet, schließlich sei sie die Mutter.
„Lass dich nicht fertigmachen“, sagte Monika, und der Beistand, den sie auch von anderen bekam, tat ihr weder gut noch schlecht. Zu benommen war sie, um glücklich darüber zu sein oder froh, das Wissen um Rückendeckung prasselte wie Wasser in eine Zisterne.
Vor vier Tagen war sie lediglich Mutter von Nils, ihrem 16-Jährigen Sohn, der zum Gymnasium ging und der sie ein ums andere Mal wahnsinnig gemacht hat. Mit seiner Lautstärke, mit seiner pubertären Pampigkeit, mit seinen unausgereiften und wöchentlich wechselnden Ansichten, wie man sie in dem Alter hat.
Den sie liebte für das, was er war und wie er war.
Nun war sie die Mutter eines Mörders, der in ein Haus eingedrungen und mit einem Freund ein Ehepaar erstochen hat – einfach so.
Über 50 Messerstiche bei jedem.
Als sie im Fernsehen Worte hörte wie „Blutrausch“ und „Wahnsinnstat“, dachte sie zunächst, welcher Geisteskranke und Perverse da zugeschlagen haben mochte.
Als sie hörte, dass Nils verhaftet worden war, weil er einer dieser beiden Geisteskranken und Perversen war, lähmte Schock die Welt ringsum.
Ein eigenartiges Gefühl, über das sie in einigen Monaten ein Buch geschrieben haben würde, nachdem ihr Sohn längst verurteilt und inhaftiert worden war.
Es war kein Gefühl inneren und äußeren Stillstands – auch keins von Eiswasser am Körper. Trudeln? Fallen? Nein. Ein Gefühl im Bauch. Ein Schmerz, der nicht fragte, ob er kommen dürfe oder nicht. Sondern der einfach kam und schlug. Seit drei Tagen schon.
Frank ist es gewesen, der recht schnell gesagt hatte: „Das liegt in unserer Verantwortung, er ist unser Sohn.“ Seitdem war er abgetaucht, dümpelte in der Trübe von Sprachlosigkeit und blickte mit stumpfen Augen nach nirgendwo. Oder in sich hinein. Oder wartete wie eine Maschine auf Standby auf einen Impuls, wieder anzuspringen, der nicht kam. Wer konnte das wissen …
Das Wort „Verantwortung“ hatte weh getan, auch „unser Sohn“. An ihnen wäre es gewesen, das zu verhindern, doch so sehr Laura nach Indizien blickte, nach Beweisen, die sie hätten übersehen können, fand sie nichts anderes als typische Dinge in einem typischen Zimmer eines typischen Teenagers.
„Die Computerspiele sind es“, sagten sie im Fernsehen, die einer ebenso geschockten wie höchst interessierten Menge die Tat zu erklären versuchte. Nils hat Spiele gespielt, auch online. Aber da traten Fabelwesen mit Waffen zwar, aber ebenso mit Zaubersprüchen gegeneinander an.
Diese Spiele haben Nils zu keinem Mörder gemacht – allein schon die Symbiose dieser beiden Worte: Nils und Mörder.
Sie erinnerte sich an die erste Begegnung mit Nils nach der Tat. Er hatte da gesessen, ihr Nils. Ernst sei er, kalt, sagten sie, doch sie wusste es besser. Er schwieg unter einer Maske. Der Mörder, der ihr gegenüber gesessen hatte im Moment ihres Eintretens kurz aufgesehen und sofort zu Boden geschaut. Geschämt hatte er sich, das wusste sie.
Als sie dem Mörder gegenüber saß, fielen ihr keine Worte ein, Frank war daheim geblieben. Er konnte den Anblick seines Sohnes nicht ertragen.
Sie auch nicht. Abscheu überkam sie, und Wut, dass sie ihn hatte schlagen wollen, mehrmals, einfach mitten ins Gesicht. Er hätte es verdient.
Nils Namen auszusprechen war schwer gefallen. Der Name verpuffte in den Universen zwischen ihnen. Kalt, sagten sie alle, die in ihm nur die Bestie sahen. Überrumpelt, sagte sie, die seine Mutter war und ihn besser kannte.
Die Stille zwischen ihnen war unerträglich laut geworden, und während sie da saß und das „Warum“ nicht zu fragen wagte, wünschte sie sich nach Hause, an den Beamten vorbei, die sie ansahen wie die Mutter eines Biests, die durch seine Geburt das Elend verschuldet hatte.
Das „Warum“ war ihrem Mund schließlich von allein entwichen – eine Antwort konnte es kaum geben, und so schwieg Nils. Er zuckte nur die Achseln.
„Warum?“ fragte sie nochmals, diesmal mit Nachdruck. „Wie kommt ein Mensch auf diese Idee? Warum TUT man so etwas?“
Auch jetzt, da sie in seinem Zimmer saß und das Monster und den Mörder darin zu finden versuchte (erfolglos) oder wenigstens Anzeichen darauf, gab es keine Antwort.
„Wir sind verantwortlich“, stammelte Frank immer wieder in die Stille hinein, wenn er überhaupt sprach. Wie sollte er jemals in seine Firma zurückkehren? Wie sollten sie das Haus halten können in dieser Umgebung, in der man sie ansah als Mörder-Eltern, deren Wertelosigkeit sich in ihrem Sohn manifestiert hatte.
Nils gab immer die Hand, wenn er Erwachsene kennenlernte. Nils gab sich immer Mühe bei der Auswahl der Geschenke für seine Eltern zu Weihnachten und zum Geburtstag. Nils hatte von sich aus einen Ferienjob gesucht, weil er sich Dinge leisten wollte, die er nicht bekam. Über diesen Nils sprach die Reportermeute nun als „Das Böse hat ein Gesicht“ und „Das Böse kam am Abend.“ Die Nachbarn sprachen nun davon, in der Nachbarschaft des Bösen zu leben, als sei Nils der Antichrist und Laura und Frank diejenigen, die die Schuld für sein Erscheinen trugen.
„Wer bist du?“ hatte sie Nils beim ersten Treffen gefragt. „Das kann doch nicht mein Sohn sein.“ Tränen quollen. „Das kann doch nicht mein Sohn getan haben! Sag mir wer du bist!“ Als sei ein Dämon in ihn gefahren, den es auszutreiben galt. „Sag mir wer du bist!“
Nils Gesicht begann sich darauf zu verformen, dass es nicht lang gedauert hatte, bis er weinte mit bebendem Körper, nicht wagte, sich hinter einer Hand zu verstecken und stattdessen zu Boden blickte.
Und „Mama“ sagte.
Mama – Verantwortung, Erziehung, Werte, Vermittlung, Liebe, Scheitern. Konzentriert in vier Buchstaben.
Es waren die letzten Worte, die sie miteinander gewechselt hatten. Sie konnte und wollte nicht Mama sein und gleichzeitig doch.
Sein Zimmer war so normal.
Das getötete Paar kannte sie nicht. Nils und sein Freund Peter hatten es sich wahllos ausgesucht, einfach geklingelt und den Mann nach dem Öffnen der Tür ins Haus getrieben mit gezückten Klingen und noch im Flur getötet. Die Frau hatten sie durch das Wohnzimmer verfolgt, zwischen Sofa und laufendem Fernseher war sie auf dem Boden gestorben. Mit Stichwunden in Brust, Rücken, Hals, sogar Gesicht.
In seinem Zimmer funkelte keine Messerklinge, keine Aggression zeigte sich. Auch die Polizei, die sein Zimmer durchsucht hatte, hatte nichts Verdächtiges finden können. Woher auch immer „das Böse“ gekommen war oder was es hatte ausbrechen lassen, niemand fand eine Antwort.
Er ist so normal.
Nach der Tat wurden Nils und Peter schon vor der Haustür von Nachbarn abgefangen, die die Schreie des Ehepaares gehört hatten. Beide Jungen waren voller Blut und hielten die Messer noch in den Händen.
Die einzigen Worte, die man bislang den beiden hatte entlocken können, waren ein gemurmeltes „Weiß nicht“ von Peter und ein „Einfach so“ von Nils.
Es quälte Laura, dass sie nicht um die Toten trauern konnte, doch dieses Ehepaar war so weit von ihr entfernt wie der Mars oder die Sonne oder Alpha Centauri.
Sie schämte sich dafür, nichts anderes zu empfinden als die Schande, versagt zu haben und sich über das Gerede anderer Leute den Kopf zu zerbrechen, und Trauer zu verspüren, weil Nils ihr und Franks Leben zerstört hatte. Ihr fielen die Worte ihrer Mutter von heute früh ein: „ Es ist nicht wichtig, wo man beginnt, die Sache zu begreifen. Wichtig ist, dass man damit beginnt.“
Beginnen, ja. Beginnen bei sich selbst. Lass es einfach fließen und sich zusammensetzen.
So kehrte die Frage zurück, die sie Nils gestellt hatte: „Sag mir wer du bist“, und die Antwort war so absurd wie einfach. Das Böse, das Biest, das Monster?
Mag sein.
Aber es kam ihr nun so vor, als hätte Nils auf Ihre Frage zu ihr aufgeblickt, sie lange angesehen und einfach das Naheliegendste gesagt: „Dein Sohn.“
Du sitzt da und schweigst, du hältst dein Glas vor dir fest und schaust verstohlen auf die Spiegelung deines Handys, während ich rede. Machst du es dir damit einfach? Oder bist du einfach nur sprachlos?
Stopp. Ich müsste mal die Klappe halten, Luft holen, einen Schluck trinken, mal sehen, was geschieht. Ich trinke, halte mein Glas weiter umfasst und warte. Auf Antwort. Auf Reaktion. Auf irgendwas.
Die Redepause nutzt du zu einem Schluck aus deinem Glas, und da kommt der Lärm von denen, die hier sitzen, stehen, trinken, essen, reden, lachen, kichern, diskutieren und schwatzen, lästern, schimpfen, sich anvertrauen, aufs Klo gehen, vom Klo zurückkehren, die Bedienungen bahnen sich ihren Weg wie tänzelnde Eisbrecher durch die Menschen, all das spritzt Gischt um uns, die wir zwei schweigende Felsen sind in einem Meer der Bewegung und des Lärms, während ich sitze und warte, während du nochmals einen Schluck aus deinem Glas nimmst. Du stellst dein Glas ab, während ich im Schwall der Worte um uns und warte.
Siehst du einem inneren Film zu? Oder starrst du einfach nur ins Nichts? Wir sind am Ende, habe ich gesagt. Es sei bedauerlich, aber verständlich, klar und in Ordnung so weit.
In Ordnung? Nichts ist in Ordnung! Aber ich kann das Rad nicht zurückdrehen, nichts wird ungeschehen sein, wie sehr ich es mir auch wünsche. Ich habe nun aufgehört zu kämpfen. Das Leben schmerzt nur solange, wie man es vergeblich zu ändern versucht. Wer aufhört, es ändern zu wollen, beginnt eine sanfte Reise auf dem Ozean der Ruhe und Stille mit dem Schiff namens Gelassenheit. Loslassen ist Befreiung.
Das Schweigen wird lang. Um uns trudelt die Welt durch ihre Bestimmung und hat mit uns nichts zu tun. Warum sagst du nichts?In meinen Därmen sprudelt die Quelle der Unruhe und im Gewirr meines Hirns beginnt das Verlangen nach Gewissheit zu sprudeln, ob ich Recht habe oder nicht.
Wir sind am Ende, habe ich gesagt. Stein für Stein hab ich die Mauer aufgebaut, um den Schmerz fern zu halten, und habe versucht, es mir dahinter gemütlich zu machen, doch nun stelle ich fest, dass ich mich durch dein Aussperren eingesperrt habe.
An einem der anderen Tische, drei Meter links von mir, in der heimeligen Ecke dort, sitzt eine junge Frau, die ebenso wartet wie ich. Der Stuhl ihr gegenüber ist leer, ihr Blick gleitet, ohne haften zu bleiben, ihre braunen Haare fallen in Locken über die Schultern, und trotz der Entfernung und des dämmrigen Lichts, das allen Kneipen zu eigen ist, da sie der Privatheit gedimmter Schummrigkeit bedürfen, trotz dieses Lichts also, das in seiner Gemütlichkeit heischenden Trübe die Farben aller Dinge in stimmungsvolles Grau zieht, erkenne ich Dutzende Sommersprossen auf ihren Wangen und Nasenflügeln. Mit großen braunen Augen betrachtet sie immer wieder ihr Handy auf dem Tisch in der Hoffnung, eine Nachricht möge kommen, die nicht kommt. Sie wartet wie ich im Stimmentosen. Sicher ist sie traurig. Ich denke mir, dass ihr bewusst ist, dass aus anfänglichem Wartenlassen, diesem Gewebe aus Langweile und Hoffnung, ein Sitzenbleiben geworden ist, eine Säure, die im Magen eines Riesen schwappt, der sie nun zu verdauen beginnt. Mit solch einem Ausgang kann sie nicht gerechnet haben, sonst wäre sie nicht hier. Hat mit Aufmerksamkeit gerechnet, sich Wichtigkeit gegeben, über die letztlich nur der Andere entscheidet – doch niemand kommt.
Ich sehe dich an und versuche zu deuten, was ich sehe. Die Tischplatte zwischen uns, auf der unsere Gläser stehen und unsere stummen Handys liegen, trennt Universen, wer hätte das gedacht!
Wir sind am Ende, habe ich gesagt, aber nur weil ich es sagte, muss ich es doch nicht wollen! Du warst mir nahe wie ein Zahn – lange Jahre ein Teil von mir, bis die Fäulnis einsetzte, warum auch immer, und nun bist du herausgerissen aus mir, die Wunde mag verheilen irgendwann, aber die Lücke wird immer bleiben.
Du schweigst, ich warte. Ich sehe dich an und wünsche mir, dein Blick ins Nirgendwo fände dort Antwort und Lösung, wünsche mir, dass du auf den großen Fang wartest, aber Hoffnung, was ist das schon, was ist es mehr als nur ein Wort, das nur Erlösung oder Vernichtung bringen kann, das uns im Dunkel unserer Wünsche und Neigungen tappen lässt, verstrickt im Außen, dem es Spaß macht, geliebt, begehrt, verehrt zu werden, dessen sadistische Befriedigung sich nur in Vorenthaltung oder Fortreißen zeigen kann, Hoffnung, diese Zersetzung, die mein Herz zerfrisst, denn ich will nur, dass du sagst, wie sehr ich im Unrecht bin, ich will, dass du mich dazu bringst, mich bei dir für meine Worte und Meinung entschuldigen zu müssen, sag was, ein Wort von mir aus nur, oder wenigstens zeig eine Geste, einen Blick, der mir zeigt, dass ich mich irre, bitte!
Themenblöcke werden zu Sand zerrieben, Jahre rieseln von uns herab. Wortlos blickst du blicklos durch den Tisch, auf dein Getränk, drehst versonnen dein Glas, und ich warte noch immer, auch wenn nun die Gewissheit Überhand gewinnt, dass alles gesagt worden ist.
Wir sind am Ende, habe ich gesagt, und habe das gesagt, was dir längst klar gewesen ist. Wir sind am Ende, habe ich gesagt, damit du es nicht zuerst sagen konntest, aber du hättest es nie gesagt. Nicht, weil du es nicht hättest wahrhaben wollen, sondern weil ich es längst hätte wissen müssen. Meine Worte waren ein Luftschnappen meiner Eitelkeit, die mich in der Illusion wiegen sollte, es wäre meine wohlüberlegte Entscheidung gewesen, das Wohlfühlprogramm in Zeiten des Unwohlseins, das nur mit Verblendung funktioniert.
Hinten in der Ecke trifft eine Frau ein, die sich zur Sommersprossigen setzt – das war es dann mit Sitzenlassen, das doch nur ein Wartenlassen war. Das war es dann mit Traurigkeit, die sich doch nur an meinem Tisch abspielt und die ich lieber dort drüben als bei mir gesehen hätte.
Nun bin ich da, wohin ich gehöre: am Ende meiner Einbildungen.
Du schweigst, aber dein Schweigen sagt alles. Es ist egal, ob du nichts zu sagen weißt oder nichts mehr zu sagen hast. Die Tischplatte zwischen uns hackt uns in zwei Regionen, da erscheint die Welt in Regenbogenfarben. In den Prismen meiner Tränen offenbart sich gar das Licht als Täuschung der Sinne, die es uns bequem machen, die uns eine Welt zeigen, die so gar nicht ist, und nur in Momenten wie diesen erkennen wir es.
Wir sind am Ende, habe ich sagt und habe es nicht so gemeint. Ich wollte, dass du es mir ausredest, dass du wütend oder traurig oder sonst was bist, aber dass du wortlos da sitzt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, wie es hätte werden können, aber die Möglichkeit einer Möglichkeit wäre tröstlich gewesen. Ein Ende wie nun ist eine Sackgasse. Sie erzwingt Umkehr und Rückzug.
Wortlos ertaste ich Geld, viel zu viel, und lege es auf den Tisch. In mir ist Beklemmung, die den Verlustschmerz gebiert. Das Ende dieses Weges mündet in das Ende aller Worte. Das Schweigen der Worte ist ein Schweigen der Zukunft.
So gehe ich, während du weiter schweigst und sich dein Blick in den Spiegelungen deines Handys verliert.

Da steht er oben auf dem 10-Meter-Brett im Freibad und will seinen Freunden mit seinem Mut imponieren – doch nun hat er einfach nur Angst, zu springen. Denn ihn erwartet nicht weniger als der sprichwörtliche „Sprung ins kalte Wasser“. Und der ist bekanntlich gar nicht so einfach und kostet Überwindung.
Was als Mutprobe beginnt, wird bald zu etwas Größerem: Einem Kampf um Selbstbehauptung, gegen die eigene Unzulänglichkeit und um den Mut, im Leben über sich hinauszuwachsen.
Der Kampf ist mühsam für den Jungen, während seine Freunde von unten „Mach schon“ rufen, schließlich setzen ihn diese Erwartungen unter massiven Druck. Wird er es wagen?
Mit „Mach schon“ habe ich mir ein Thema vorgenommen, das vor allem für Jungen zum Leben dazugehört: Mutig und männlich zu sein, den Erwartungen entsprechen zu müssen sowie die Sorge, die Anforderungen nicht erfüllen zu können.
Erzählung „Mach schon“ für Leser mit tolino, Kobo im EPUB-Format kostenlos downloaden:
Erzählung „Mach schon“ für Leser mit Kindle und anderen Geräten im MOBI-Format kostenlos downloaden:
Mach schon – Oliver Koch Mach schon – Oliver Koch
Tatsächlich war ich als Junge in einer ähnlichen, wenn auch deutlich undramatischeren Situation: Ich war Keep Reading
Das Sterben eines Unternehmens als Mitarbeiter zu erleben, ist eine Erfahrung, die man so schnell nicht vergisst. Im Sommer 2003 entließ die Firma, in der ich damals angestellt war, über mehrere Wochen mehr als die Hälfte der 170-köpfigen Belegschaft und ging kurz danach ganz unter.
Entlassene Mitarbeiter wurden freigestellt und hatte nach ihrer Kündigung lediglich eine Stunde, um ihren Schreibtisch zu räumen und das Gebäude zu verlassen.
In meiner sehr kommunikativen Funktion bekam ich hautnah mit, wie sich Büros leerten und ganze Räume plötzlich unbesetzt waren.
Mich und meine Kollegin traf es schließlich am Ende der zweiten Entlassungswelle. Es war abzusehen, schließlich hatten wir bereits nichts mehr zu tun und saßen unsere Arbeitszeit mit Warten ab.
Damals beschäftige mich das Ganze derart, dass ich mit „Die Ruhe vor dem Knall“ dieses Firmensterben in Worte fassen musste.
Ironischerweise schrieb ich gerade daran, als wir zum Vorgesetzten gerufen wurden, um unsere Kündigungen entgegenzunehmen.
Ich fuhr nach Hause, informierte die Familie und schrieb den begonnenen Text am selben Nachmittag zu Ende.
Seitdem habe ich den Text absichtlich nicht weiter bearbeitet – ich wollte ihm nicht seine Unmittelbarkeit nehmen, aus der er entstand.
Heute, 15 Jahre später und zumindest klimatisch mit einem ähnlich heißen Sommer konfrontiert, sind mir diese Tage und der besagte Tag noch immer äußerst präsent, wenn ich „Die Ruhe vor dem Knall“ lese. Sie ist noch immer meine persönliche Schau auf die Ereignisse, die ich hoffentlich weder so, noch in abgewandelter Form wieder erleben möchte.
Erzählung „Die Ruhe vor dem Knall“ für Leser mit tolino, Kobo im EPUB-Format kostenlos downloaden:
Die Ruhe vor dem Knall – Erzählung von Oliver Koch
Erzählung „Die Ruhe vor dem Knall“ für Leser mit Kindle und anderen Geräten im MOBI-Format kostenlos downloaden:
Was war ich baff, als ich erfuhr, dass meine Science-Fiction-Erzählung Ans Tageslicht als Beste deutschsprachige SF-Erzählung des Jahres 2017 für den Kurd Laßwitz Preis nominiert wurde – und was fühlte ich mich geehrt! Es ist ja nicht so, dass mit die Auszeichnung unbekannt ist oder mir Kurd Laßwitz nichts sagt.
Erschienen ist die Geschichte im Anthologie-Band Meuterei auf Titan: 2016 Collection of Science Fiction Stories aus dem Verlag für Modernde Phantastik, in dem auch bereits die Vorjahres-Anthologie Im Licht von Orion: 2015 Collection of Science Fiction Stories mit meiner Story Fehler im System erschien.
Ans Tageslicht erzählt die Gescheite eines Mannes, der bei einem abendlichen Spaziergang ein Stück Plastik aushustet. Für ihn ist klar: Er ist ein künstlicher Mensch! Fortan sieht er überall Beweise für seine Künstlichkeit. Was, wenn er Teil einer weltumspannenden Verschwörung ist?
Gelesen habe ich sie bislang im Rahmen der Buch-Vorstellung bei der BuCon 2017, ihre Premiere feierte sie jedoch einige Jahre früher bei der 1. Karlsruher Lesenacht der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe.
Ob die Story letztlich gewinnt, kann ich nicht sagen – soviel aber sei bemerkt: Toll ist es auch so.
Da staunt die Hausgemeinschaft nicht schlecht, als ein unbekanntes Ding in ihren Garten einschlägt. Ratlos stehen die Nachbarn beisammen und versuchen zu klären, was da eigentlich vom Himmel gefallen ist. Ein Satellit? Ein Ufo? Oder etwas ganz anderes?
Einigkeit besteht darin, dass jedem die Worte fehlen, sodass „Ähem“ alles ist, was ihnen einfällt. Dich vielleicht gibt es da ja noch eine andere Lösung …
Der Name sagt es schon: „Das Ähm ins M’s Garten in der Nähe von Emsdetten“ geht als Ironie durch. Denn was passiert denn, wenn wir etwas sehen, das wir nicht fassen können? Reichen unsere Begriffe nicht aus, oder sind es unsere Denkmuster?
Während wir den Nachbarn beim Staunen und Wortfinden zusehen, können wir uns selbst dabei betrachten, wie wir wohl vorgehen würden.
Die Story ist wie immer kostenlos für die Formate epub sowie mobi, damit sowohl Leser eines Kindle, als auch anderer Reader auf ihre Kosten kommen können.
Viel Spaß beim Lesen.
Erzählung „Das Ähm in M’s Garten in der Nähe von Emsdetten“ für Leser mit tolino, Kobo im EPUB-Format kostenlos downloaden:
Das Ähm in M’s Garten in der Nähe von Emsdetten von Oliver Koch im EPUB-Format
Erzählung „Das Ähm in M’s Garten in der Nähe von Emsdetten“ für Leser mit tolino, Kobo im EPUB-Format kostenlos downloaden:
Das Ähm in Ms Garten in der Nähe von Emsdetten von Oliver Koch als eBook im MOBI-Format
Ganz sicher hätte unser Protagonist von „Nach Irgendwo“ nicht damit gerechnet, dass ihm so etwas passieren würde; denn eigentlich hat er nur früher Feierabend und sich früher als sonst auf den Heimweg gemacht. Klar, der Popel in seiner Nase stört ihn, und man weiß ja, wie sehr man gerade dann beobachtet wird, wenn man es nicht ahnt. Aber was soll man machen, wenn man an der Haltestelle steht und auf seine Bahn wartet?
Man fügt sich in sein Schicksal.
„Nach Nirgendwo“ habe ich als mysteriöse Geschichte gleich auf dem Cover gekennzeichnet. Ein klein wenig möchte ich ja, dass der Leser, wenn er sich schon keine Vorstellung von dem machen kann, was passiert, zumindest ahnt, was da in etwa auf ihn zukommt.
Die Geschichte fiel mir ein, als ich – tja, was wohl? – an einer Haltestelle stand und auf meine Bahn wartete. Es war im übrigen die Haltestelle Ettlingen-Stadt, und so mag man das Bild mitnehmen, wenn man die Geschichte liest. Gebunden an den Ort ist sie allerdings nicht.
Und mir fiel sofort der erste Satz ein, mit der „Nach Nirgendwo“ beginnt: „Er widerstand zu popeln.“ Das ist so ein Satz, von dem ich nicht mehr loskam. So kam es, dass ich die Geschichte im Kopf hatte, während ich irgendwann im Sommer 2012 heim fuhr und sie dann schrieb, kaum dass ich zuhause war. Da ich Geschichten meist nie am Stück herunter schreibe, nehme ich rückblickend an, dass ich auch hier einige Tage bzw. Abende am Werk war.
So übergebe ich jetzt direkt an die Geschichte selbst und das mysteriöse Ereignis, das sie beschreibt.
Viel Spaß beim Lesen!
eBook für Leser mit tolino, Kobo im EPUB-Format kostenlos downloaden:
Nach Nirgendwo. Erzählung von Oliver Koch
ebook für Leser mit Kindle und anderen Geräten im MOBI-Format kostenlos downloaden:
Nach Nirgendwo: Erzählung von Oliver Koch