Mystery-Roman von Oliver Koch
Der Wind von Irgendwo von Anfang an lesen
Erst Kapitel 6 lesen
Als das Licht die Landschaft beleuchtete, schien sie es in anderem Licht tun zu wollen. Die Schatten warten merkwürdig lang, und das Zwitschern der Vögel erinnerte mehr an das höhnische Lachen etwas Fremdem, das sich über das Dorf und sein Schicksal belustigte.
Doch wie immer begann der Morgen mit dem Üblichen: als die Hähne bei den ersten Sonnenstrahlen dieses Morgens auf der Höhe des Sommers krähten, verließen viele ihre Betten, um die Kühe und Ziegen zu melken. Rund um sie war es dabei noch dunkel genug, dass die Ställe wie Höhlen anmuteten. Dann ergriffen sie Behälter, stellten sie unter die Tiere und melkten sie, wie es gelernt hatten. Es war wie seit jenen Tagen, da das Erinnerungsvermögen bei den Menschen des Dorfs einsetzte, so, wie es schon immer in ihren Erinnerungen gewesen war, und wie es auch im Erinnerungsvermögen der mittlerweile Toten gewesen war.
Die Frauen waren mit Brotbacken beschäftigt zu Zeiten, da noch nicht jeder erwacht war. Der Tag kehrte schrittweise zurück, und die Helligkeit kam mit dem Wind. Und obwohl alles wie immer schien, erwachten sie alle mit einem Gefühl der Beklemmung.
Dieser Tag war anders als die anderen. Dieser Tag war der erste Tag, da der Himmel ein großes Auge war und ein großes Ohr zudem, wo die Gräser und Blumen Augen besaßen und alle Tiere Auskundschafter waren.
Das Gefühl der Fremde nahm von Lorn Besitz, kaum dass er wach war.
Der Himmel hatte geweint. Der Himmel hatte über sie alle geweint, auch über ihn, und das war das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte. Was hatte er die ganze Zeit falsch gemacht? Was hatte er sich zu Schulden kommen lassen? Warum verlor eine Macht, dessen Gestalt und Ursprung er nicht einmal erfassen konnte, eine Träne über ihn und seine Umgebung? Es war so furchtbar. Er dachte an das Buch und an das Bild darin. Dieser mysteriöse Mann mit dem seltsamen Schein um den Kopf und den Löchern in den ausgestreckten Händen, der verkrusteten Stirn und dem nicht erklärbaren Gesichtsausdruck: er hatte die Frau zu Tode erschreckt, sie fürchtete sich vor diesem Mann. War es wegen des Scheins, den er um den Kopf trug?
Lorn hatte keine Lust, einem Menschen zu begegnen, der dergestalt aus der Höhle kam. Aber darum hatte der Himmel wohl geweint. Es waren wohl neue Zeiten angebrochen, ein Umstand, den niemand von ihnen deuten konnte.
Wenn das hieß, dass nichts mehr so sein sollte, wie es gewesen war, Tag für Tag und Jahr für Jahr seines ganzen bisherigen Lebens, dann wollte er diese neuen Zeiten nicht.
Wie sehr sehnte er sich danach, aufzuwachen, das gewohnte Zimmer zu erblicken und seine Frau neben ihm, die noch zusammengerollt schlief und die er nicht wecken wollte, eingehüllt in den Schein eines noch frühen Morgens mit den Geräuschen der Vögel und wissend, dass dieser Tag die übliche Arbeit brachte, um dann abends am Feuer zu enden.
Er wollte nun lieber herausgehen und Holz hacken für das Feuer heute Abend. Er wollte frühstücken, wollte durch das Gras marschieren und Jessica den Hintern versohlen, wenn sie wieder unartig war, aber er wollte nicht diese neuen Zeiten.
Er stand auf und redete sich ein, dass es sie niemals anbrechen würden. Alles sollte so sein, wie es immer gewesen war, seit Anbeginn der Zeit, und diese Sache mit dem weinenden Himmel und dergleichen war nichts anderes als ein seltsamer Traum. Jeder hatte einen früher oder später.
Einmal hatte eine Frau, die nun tot war seit langer Zeit, als er noch ein Kind gewesen war dass sie in seiner Erinnerung nur als nebulöses Etwas ohne Züge Einzelheiten erschien,, einen Traum gehabt wie diesen. Sie war fest davon überzeugt gewesen, dass dieser Traum kein Traum war. Sie hatte ihr Leben umgestellt, hatte nach Dingen gehandelt, die sie für geschehen hielt, die es in Wirklichkeit aber nie gegeben hatte. Sie war schon sehr alt gewesen, aber ihr Leben, das ebenso harmonisch und gleichmäßig verlaufen war wie das von Lorn, war nach diesem Traum ein völlig anderes. Dabei hatte jeder gewusst, dass die Frau nur einen Traum gehabt hatte.
So eine Episode hatte auch Lorn nun offenbar erlebt, denn er sah sich um, und alles war wie früher. Das Licht eines erwachenden Morgens hauchte alles ein in den Schein von Frieden, und seine Frau, die er nicht wecken wollte, lag zusammengerollt neben ihm. Die Decke hob und senkte sich regelmäßig mit ihren Atemzügen, die wispernd in der Luft hingen.
Wohlgemut stand er auf, trat auf das Stück Boden, das immer knarrte, wenn er es betrat, wusch sich an einem Eimer Wasser, den er am Vorabend zu diesem Zweck gefüllt hatte, und es war angenehm kühl. Er ging in die Wohnküche und brach einen Laib Brot, nahm sich einen kleinen Eimer und ging nach draußen, um eine Kuh zu melken.
Es war nichts anders an diesem Tag, bis er auf dem Rückweg zum Haus Karul traf, der ebenfalls vom Melken zurückkehrte.
»Morgen, Lorn.«
»Morgen, Karul. Hast du gut geschlafen?«
»Wie man so schläft. Und du?«
»Gut. Bestens. Ich habe gar nicht aus dem Bett kommen wollen.«
»So geht es uns allen, oder?«
»Ja. Kannst du mir helfen, heute mittag einen neuen Zaun für die Pferdekoppel zu bauen? Nachher rennen sie uns fort und wie haben keine Pferde mehr.«
»Sicher, Lorn, wenn ich Zeit habe. Ich bin heute erst auf dem Feld, das bestellt werden muss. Lass es uns morgen machen. Dann habe ich mehr Zeit und bin ausgeruhter.«
Lorn setzte seinen Eimer ab. »Ist dir was an meinem Sohn aufgefallen?«
»An Mark? Was denn?«
»Ich weiß nicht recht, aber es kann gut sein, dass ich mich irre, aber ich denke, er hat eine Erfahrung gemacht, die jeder macht.«
»Findest du? Kann schon sein, Lorn, kann schon sein.«
»Hast du ihn nicht mit Sarah verschwinden sehen?«
»Nein, habe ich nicht.«
»Ich aber.«
»Machst du dir Sorgen?«
»Nein, gar nicht. Ich freue mich für ihn. Und für sie auch. Ich gönne ihr Mark. Er ist ein Prachtbursche.«
»Ja, das ist er. Manchmal kommt mir der Gedanke, dass er uns eines Tages alle überflügelt.«
»Warum sollte er das? Und wie?«
»Ich weiß es nicht. Er ist so reif, so gerecht, und das schon immer. Wenn ich daran denke, wie er mit Jessica umgeht. Ich an seiner Stelle hätte ihr schon längst den Kopf abgerissen.«
»O ja, ich auch. Aber sie ist keine Göre. Sie ist nur lebhaft und gemein wie alle Mädchen ihres Alters. Und sie ist auch nicht dumm. Und das macht mir zur Zeit Sorgen.«
»Wie meinst du das?«
Lorn wurde nachdenklicher. »Sie scheint keine Angst vor Tirata zu haben. Sie schient mir zu neugierig. Sie ist von der Hexe gefangen!«
»Übertreibst du da nicht ein wenig?«
»Jessica ist wie besessen von ihr. Sie spricht mit ihr wie mir ihren Freundinnen. Sie hat mich bei ihr wie einen Trottel aussehen lassen.«
»Wenn ihr Weg der Tiratas ist, wirst du das nicht verhindern können.«
»Nein, das wage ich mich auch gar nicht. Wer weiß, was das alte Weib dann tut, wenn ich es meiner Tochter verbiete!«
»Wenn du eine Tochter verlieren solltest, gewinnst du eine Wahrsagerin.«
»Ich will keine Hexe aus meinem Haus.«
»Du übertreibst wieder. Und außerdem: sei stolz, eine Wahrsagerin gezeugt zu haben, sofern sie denn eine wird. Das wird dir Achtung im Dorf bringen.«
»Ach, zum Teufel damit!«
»Du unterschätzt das, Lorn. Du wärst geachtet als Vater der Wahrsagerin.«
»Aber ich will doch keine Angst haben müssen vor meiner eigenen Tochter!«
»Sie ist dann nicht mehr deine Tochter. Sie ist dann die Tochter des Windes, und sie wird weise sein und dir als ihren Erzeuger schon nichts antun.«
»Ich will es dennoch nicht. Ich will meine Tochter nicht verlieren, schon gar nicht an Tirata!«
»Und du könntest es dennoch nicht verhindern. Und wenn es dein Sohn nicht schafft, uns alle zu überflügeln, dann schafft es deine Tochter ganz sicher.«
»Das ist ein schwacher Trost für den Verlust der eigenen Tochter.« Lorn schwieg eine Weile, und die Schatten wurden langsam kürzer. »Wie dem auch sei. Ich freue mich für Mark. Und du hast wirklich nichts gesehen?«
»Ich habe selbst Kinder, auf die ich mehr achte als auf die anderer Leute, Lorn.«
»Sicher, natürlich.«
»Du bist etwas verwirrt, Lorn. Du sorgst dich zu viel, und deine Gedanken sind nicht mehr ganz gerade, finde ich. Betrachte die Sache mit Jessica als gewollt. Ihr wird das Wissen nicht schaden, und wenn sie auch in deinen Augen wunderlich werden sollte, so wird sie es wohl nicht werden, ohne es zu wollen. Vertraue auf das Schicksal. Es macht schon keine Fehler.«
»Du hast wohl recht, Karul. Ich hoffe, ich bin dir so früh am Morgen nicht zur Last gefallen.«
Karul huschte ein schäbiges Grinsen über die Züge. »Das bin ich durch meine Frau wohl gewohnt, und sie plappert viel mehr wirres Zeug als du. Wir sehen uns.«
So nahmen sie wieder ihre Eimer mit frischer, noch warmer Milch und gingen ihrer Wege in ihre Küche, um dort mit einem guten Frühstück angemessen den Tag zu beginnen.
Im Hause Tsams begann nun das zweite Mal ein Tag ungewöhnlich. Jeder, der im Haus erwachte, wusste, dass etwas fehlte. Maraims Anwesenheit war, das leuchtete nun den Eltern und Tsam ein, in gewisser Hinsicht marternd gewesen. Maraim war der schwarze Schatten im Haus gewesen, das Loch des Bösen und des Abscheulichen, das zu Zeiten, da es noch anwesend gewesen war, seinen massigen, unansehnlichen Körper, vor dem man stets zurückwich, durch das Haus gewuchtet hatte, um Unfrieden zu stiften.
Tsam hatte Mariam tatsächlich gehasst, und um so beglückter war er über sein Verschwinden. Immer hatte er sich gewünscht, dass Maraim verschwand und nie wieder auftauchte. Zugegeben, diese Angst vor Maraims Zurückkehren steckte Tsam in den Knochen – aber die Tatsache, dass der Bruder so lange fort war, war in gewisser Hinsicht erleichternd. Die Luft roch anders, denn sie erinnerte nicht an Maraim, da man sicher sein konnte, dass dieser sie nicht eingeatmet hatte. Ein Loch klaffte im Haus, und dieses Loch war eines dieser Art von Löchern, an deren Rand man steht und auf eine hinabgestürzte, gefallene Stadt der Feinde hinabblickt, die nun in Trümmern weit unter den Füßen liegt und niemals mehr aufersteht.
Dieses Loch war ein stiller Triumph und allgegenwärtig. Eine Art von verpestendem, lähmendem Gestank war aus dem Haus gewichen, und dennoch war niemand glücklich. Er hatte sich an dem Streich beteiligt, wegen dem Maraim davongelaufen und verschwunden war, was ihn mit Schuld erfüllte. Denn er fragte sich, was aus Maraim geworden sein mochte. Wölfe hätten ihn zerreißen können, langsam, blutig und qualvoll. Die Schmerzen waren für Tsam auf lächerliche Weise nachvollziehbar, da er sich daran erinnert fühlte, wie er in einen Dornenbusch gefallen war und sich böse Risse zugefügt hatte. Wie sehr musste es schmerzen, wenn scharfe Zähne sich nicht nur zentimetertief in die Haut bohrten, sondern ganze Stücke heraus- und Gliedmaßen abrissen? Was, wenn er ertrunken war? Wenn all die Luft ausging, dann musste das ein schrecklicher Tod sein. Oder wenn er in die Corrin-Höhle gelaufen war und dort den schrecklichsten Geheimnissen begegnet war, um von ihnen auf eine nicht vorstellbare Art und Weise getötet zu werden?
Er gönnte Maraim viel Schlechtes, doch konnte er es nicht verkraften, dass er Schuld sein sollte.
Dieses Loch im Haus, das Mairaims Fehlen hinterließ, beängstigte ihn. Trotz allen Hasses, den er hegte, wünschte er sich, Maraim unten in der Küche zu sehen, liegend im eigenen Erbrochenem, sich an nichts erinnernd und so widerlich wie früher. Tsam würde seinem Bruder anders begegnen: Wer sich nicht wehrte, war selbst Schuld, dachte er sich und fand sich im Recht, er nun Maraim die Stirn bieten würde.
Er stand auf. In der Küche fand er seine Eltern, die ihn hatten schlafen lassen.
»Seid ihr schon lange wach?«, wollte er wissen.
»Schon seit einiger Zeit«, antwortete ihm seine Mutter.
»Warum habt ihr mich nicht geweckt?«
»Warum hätten wir das tun sollen? Hast du heute etwas vor?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Heute wird es wieder sehr warm, fürchte ich«, meinte der Vater nachdenklich, und das Licht des reifen Morgens wallte wie der Umhang einer großen Fee durch die vielen Fenster. »Es wird Zeit, dass es wieder regnet, sonst trocknet uns das Land aus.«
»Es wird schon regnen, früher oder später«, meinte die Mutter. »Das hat es immer getan.«
»Das stimmt nicht. Vor ein paar Jahren hat der Regen auf sich warten lassen, und unsere Ernte war so gut wie ruiniert. Ohne unsere Vorräte hätten wir harte Zeiten gehabt.«
»Aber auch jetzt hätten wir Vorräte, wenn es zu einer Dürre kommen würde.«
»Das ist richtig, ja.«
»Warum ist der Himmel eigentlich immer so wütend, wenn er und nach langer Zeit der Hitze Regen schickt?«, fragte Tsam unbedarft. »Es ist jedesmal so, nie anders.«
»Das ist so eine Sache«, antwortete sein Vater, und er setzte sich gemütlicher auf seinen Stuhl. »Tirata hat gesagt, der Himmel würde seine Wut ausspeien in Lärm. Sie sagte, es sei einer Warnung an uns. Der Himmel würde uns strafen wollen mit einer Dürre, damit wir auf den Pfad der Erkenntnis zurückkehren, wenn wir davon abweichen, und dann, wenn wir wieder darauf zurückgekehrt sind, schenkt er uns Wasser, damit wir überleben, aber er warnt uns und brüllt uns an.«
Tsam sah zu Boden, und sein Herz wollte nicht mehr schlagen. »Dann will uns der Himmel jetzt also strafen.«
Sein Vater schluckte. »Das will er, ja. Das will er.«
»Und … vielleicht schickt er uns keinen Regen, weil er uns jetzt richtig strafen möchte?«
Das Licht fiel ein und warf Schatten, warf dunkle Dämonen ins Haus, und Tsam erhielt darauf keine Antwort.
Jessica hatte gute Lust, mit ihrem Frühstück zu spielen und zu-dem noch das unbändige Verlangen, Mark zu ärgern. Aber sie tat es nicht. Sie tat es deshalb nicht, da sie sich dachte, dass es albern wäre. So etwas taten nur Kinder, die nichts Besseres zu tun hatten. Sie hatte selbstverständlich etwas Besseres zu tun. Sie musste nun essen, aber nicht, weil man es ihr gesagt hatte, sondern weil sie zu Kräften kommen wollte. Sie wollte stark sein für das, was sie heute zu tun beabsichtigte. Das, was in ihrem kleinen, klugen Kopf an Plänen vorging, war wahrhaft kühn und im Dorf einmalig. Dass gerade ein kleines Mädchen wie Jessica darauf kam, so etwas zu tun, was jedem ausgewachsenem, mutigem Mann aus dem Dorf Angstschweiß auf die Stirn getrieben hätte, war sicherlich ungewöhnlich. Aber Jessica sah ihren Weg. Jessica konnte nicht von sich behaupten, dass sie auch nur entfernt verstand, was vor sich ging und was Tirata repräsentierte. Aber sie wusste – nun gut, das wusste jeder – dass Tirata das Symbol für das Mächtige in allem war. Sie war der Schlüssel zum Raum, den niemand außer Tirata betrat, und dieser Raum war für die meisten die Corrin-Höhle, und nur sie.
Jessica hatte da schon ein paar Schritte mehr getan, und das war bemerkenswert. Zwar war sie der Ansicht, dass dort in der Corrin-Höhle, und nur dort das Zentrum all dessen lag, das sie Welt auf so unverständliche, übermenschliche Art und Weise bestimmte; aber der Einfluss von diesem ging weit über die Corrin-Höhle hinaus. Da war Tiratas Haus, da war der Frauenbaum, da war der Wald etwas weiter fort, da waren die Berge … all das musste irgendwie dazugehören.
»Iss weiter und hör‘ auf zu träumen«, hörte sie ihre Mutter sagen.
Jessica sah hoch und blickte ihr in die Augen.
»Sieh mich nicht so an«, ermahnte die Mutter. »Hast du geträumt?«
»Ich glaube schon«, meinte Jessica leise und aß weiter.
Es herrschte Schweigen im Haus. Jeder aß für sich, und den Eltern fiel der merkwürdig traurige Gesichtsausdruck Marks auf, der aß und auf den Tisch starrte. Seine Augen waren feucht und ausdruckslos, sein Blick verklärt. Seine Glieder waren schlaff und seine Mundwinkel nach unten gezogen.
Niemand war an diesem Morgen in der Stimmung zu reden, und Lorn sah Mark an und fragte sich, was wohl in ihm vorging. Mark war mit Sarah zusammen gewesen, und nun war er traurig. Jessica interessierte sich magisch für Tirata und schwieg gleichfalls, obwohl in ihrem Gesicht keine Trauer, aber Merkwürdigkeit blitzte.
Lorn konnte diese Anblicke kaum ertragen. Seine Augen wanderten von seinem Sohn zu seiner Tochter und wieder zurück, und er wusste, dass etwas mit ihnen nicht mehr so war wie früher. Was war nur so anders geworden? Was ging vor im Dorf, was veränderte die Menschen so?
Obwohl Karul ihm gesagt hatte, dass alles doch normal war, konnte Lorn es nicht glauben. an. Es fühlte sich schlecht und ausgehöhlt. Aber wohlmöglich war er nur einer Einbildung erlegen. »Hilft mit heute jemand, einen neuen Zaun für die Pferdekoppel zu bauen? Sonst rennen uns noch die Pferde fort.« Er war überrascht, wie gelassen und ausgeglichen das geklungen hatte.
»Ich bin doch viel zu klein dafür«, meinte Jessica in dem Ton, den sie immer anschlug, wenn sie sich vor Aufgaben drücken wollte. »Ich könnte ja doch nur zugucken, und es ist mir zu langweilig.«
»Aber du warst doch sonst auch immer dabei. Du kannst ja mit deinen Freundinnen spielen.«
»Eigentlich wahr. Vielleicht. Wenn ich nicht komme, ist das ja auch nicht so schlimm, wo ich dir ja doch nicht helfen kann.«
Ihre Mutter schlug vor: »Du kannst mir doch beim Weben helfen, das machst du doch sonst so gerne.«
Jessica zuckte die Achseln. »Mal sehen.«
»Nein, du siehst nicht. Du hilfst.«
»Gut.«
Mark hatte die ganze Zeit dabei gesessen, als hätte er nichts gehört, und das hatte er auch nicht. Er jagte den Phantomen nach, die ihn quälten. Noch nie hatte sich der Himmel so direkt an ihn gewandt.
»Dann hilfst du mir heute, Mark«, bestimmte Lorn.
Mark hörte nichts.
»Mark!«
Mark schreckte auf. »Was?«
»Lieber Himmel«, entfuhr es Lorn, »was ist heute eigentlich hier los? Träumen heute denn alle? Bist du jetzt in der Lage, mir zuzuhören, wenn ich dir jetzt etwas sage?«
»Ja, Pepe.«
»Gut. Du hilfst mir heute beim Zaun um die Pferdekoppel. Karul hilft wohl auch mit, und ich kann jede Hand gebrauchen. Hast du das mitbekommen?«
»Ja.«
»Gut.«
»Aber der Zaun ist doch in Ordnung«, widersprach Mark plötzlich recht teilnahmslos. »Wir haben ihn doch erst im Apriliam repariert. Das hält bis ins nächste Jahr.«
»Nein, tut es nicht. Ich habe ihn mir letztens angesehen. Wir haben wohl keine gute Arbeit geleistet, denn er muss an einigen Stellen neu gemacht werden, und du hilfst mir dabei, keine Widerrede. Und nun esst beide weiter, haltet den Mund und stellt euch auf Arbeit ein.«
Und so kam wieder Ruhe an den Tisch zurück, bis das Frühstück beendet war.
Mit zunehmender Sonne stieg auch die Temperatur in unerträgliche Höhen. Über das Dorf spannte sich die riesige, tiefblaue Netzhaut des Himmels. Die Tiere standen auf ihren Weiden und verhielten sich still, und wo Bäume standen, drängten sie sich in ihre Schatten. Manche legten sich in den kühlenden Schutz von Hecken und Büschen.
Nicht ein Lufthauch regte sich. Jessica war mit ihrer Mutter ins Haus zum Weben zurückgekehrt, da es dort wesentlich kühler war als draußen, wenngleich auch das Holz die Hitze von außen aufsog. Die Balken schienen brennen zu wollen, und die Luft war stickig und ließ jeden Laut ersterben. Jede Bewegung war anstrengend, und zu dem im Haus vorherrschenden Holzgeruch kam nicht nur der des verwebten Stoffes, der die Luft nur noch trockener machte, sondern auch der des Schweißes von Jessica und ihrer Mutter, die häufig ihre Arbeit mit Keuchen unterbrach.
»Das ist grässlich«, sagte sie schnaufend und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ihre Haare klebten an der Stirn, ihre Ärmel hatte sie hochgekrempelt. »Ich kann kaum etwas machen, Jessica. Lass uns aufhören.«
»Ja, das wäre wohl besser.«
»Geh mit deinen Freundinnen im Bach schwimmen, ja? Vielleicht sind sie schon alle da.«
»Bestimmt sind die das«, erwiderte Jessica, die neben ihrer Mutter saß und ihr nicht einmal geholfen hatte. »Aber willst du nicht mitkommen? Es sind sicherlich nicht nur Kinder da.«
»Ich komme nach, Jessica, verlass dich drauf. Und nun geh, wenn du willst.«
Natürlich wollte sie. Also stand sie auf und ging hinaus, ließ ihre Mutter allein im brütend heißen Haus zurück.
Schon von weiter Ferne hörte sie Rufen und aufstobendes Wasser, und als sie den Bach sah, umgeben von Bäumen und Gräsern und Büschen und Blumen, stellte sie fest, dass fast das ganze Dorf sich in einer Länge von mehr als zweihundert Metern im Wasser des an einigen Stellen sehr tiefen Baches stand oder lag. Er bot mit einer durchschnittlichen Breite von etwa fünf Metern genügend erfrischendes Wasser für alle. In den Uferzonen und zahlreichen Nebenärmchen, in denen das Wasser stand und sich teilweise zu bizarren Teichen und Tümpeln ausgebreitet hatte, lebten Frösche, und kein Mensch wagte sich dort hinein.
Jessica gesellte sich zu ihren Freundinnen und genoss das kühle Wasser.
»Jessica, wo ist denn deine Mutter?«, wurde sie von einer Frau gefragt, mit der ihre Mutter sich manches Mal unterhielt.
»Sie ist noch im Haus, Ara, aber sie will gleich nachkommen. Sie wollte weben.«
»Dazu ist es doch viel zu heiß!«
»Deshalb kommt sie ja auch gleich.« Jessica wurde nassgespritzt und untergetaucht, und sie wehrte sich nach Kräften wie immer. Sie war für einige Momente die übliche Kratzbürste, in denen sie um sich schlug und trat, harte Worte benutzte und krakeelte, wie es nur Jessica unter ihresgleichen im Dorf tun konnte.
Dann aber kam ein überraschender Windzug auf, kurz, aber stark, und die Badenden nahmen ihn wie Labsal auf. Dieser Augenblick war für alle schön und viel zu kurz, für Jessica verwunderlich, denn sie fühlte sich durch diesen Luftzug von etwas Außergewöhnlichem berührt, und sie blieb im Wasser stehen und ignorierte alle Einladungen zum weiteren Spiel. Sie stand da und starrte zu den Bergen, die nie ein Mensch betreten hatte, die nie ein Mensch erklommen und überblickt hatte, obgleich der Wind, den alle so ersehnten und eben so gelobt und wie Labsal aufgenommen hatten, von eben diesen Bergen kam. Und in diesen Bergen lag auch die Corrin-Höhle. Spie etwa sie den Wind aus?
Jessica ging aus dem Wasser und suchte ihre Sachen zusammen. Niemand rief ihr hinterher, als sie in die Richtung von Tiratas Haus ging, um endlich dort anzuklopfen und jemand anderes zu werden.
Und ihre Mutter, die, als sie zum Bach gehen sollte, ihre Tochter zum Haus der Wahrsagerin gehen sah, rief Jessicas Namen, doch sie reagierte nicht und ging dessen ungeachtet weiter, weiter den Weg, den sie zu gehen gezwungen zu sein schien.
Ihre Mutter stand allein im Dorf, aufgewühlt von der Tragweite dessen, was die Schritte ihrer Tochter bedeuteten. Sie sah ihre Tochter, wie sich von ihrem Dorf und dem gewohnten Leben ein für alle Mal entfernte.
Wie alles um ihn schwieg, als wollte es erst neu erweckt werden. Mark indessen schwitzte mit seinem Vater und fand seine Arbeit so sinn- wie trostlos. Lorn hingegen war eifrig bei der Arbeit, mit freiem Oberkörper riss er Pflöcke aus der Erde und rammte neue mit solcher Kraft wieder hinein, dass es Mark schauderte.
Das Gras um sie, das ihnen bis zu den Knien reichte, war von ausgeblichenem Dunkelgrün – es war durstig wie Mark und ebenso kraftlos. Die Pferde hatten sich unter Bäume geflüchtet und standen geduldig da.
»Du bist still, Mark. Ist was?« Dabei arbeitete Lorn weiter und erzwang sich einen Ton der Gelassenheit.
»Nein, nichts.«
Wieder Stille. Lorn arbeitete weiter und nahm den Geruch der Blumen, die dem dichten Teppich des Grases ein wunderschönes Muster verliehen, wohlwollend auf. »Du machst aber den Anschein. So still bist du doch sonst nicht. Erzähl mir nicht, dass dich nichts bedrückt.«
»Nein, es ist nichts.«
»Gut, wenn du meinst. Gib mir einen Pflock.«
Mark gehorchte schwieg. Seine Augen nahmen wie so oft das auf, was um ihn war, und es war wie immer berauschend schön, und es würde immer berauschend schön sein, ganz gleich, wie oft und wie lange man es sich ansah. Was hatte er in dieser planen Landschaft, die sich nur über einige weit ausladende, seichte Hügel schwang, alles erlebt. Es hatte nur schöne Momente gegeben, kaum oder nie Dinge, die ihn betrübt hatten, und so war ihm das Gefühl von Sorge und Schuld bislang fremd – um so zerstörender wirkte es nun auf ihn.
»Es ist alles so anders«, sagte er plötzlich, ohne den Blick von der Landschaft zu nehmen.
Lorn hielt inne. »Alles geht seinen Weg, Mark. Ich habe mich auch seltsam gefühlt.«
»Ich bin so verwirrt. Es ist zu heiß, es ist zu still, seitdem der Himmel geweint hat.«
Lorn holte tief Luft und sah in Sonnenrichtung. »Ja, wir haben wohl Fehler gemacht.«
»Was meinst du, werden wir in die Höhle gehen?«
»Wir werden warten müssen, was Tirata sagt. Wenn sie meint, dass wir es tun sollten, wird kein Weg daran vorbeigehen.«
»Die Höhle macht mir Angst.«
»Ist es wirklich das, was dich bedrückt, Mark? Oder ist es etwas anderes? War es nicht so gut, wie du es dir vorgestellt hast? Das macht doch nichts. Es wird wieder werden.«
Mark sah ihn. »Was, um Himmels willen, meinst du?«
Lorn zuckte mit den Achseln. »Nun, ich bin nicht blind. Ich habe gesehen, wie du mit Sarah verschwunden bist.«
Mark wurde rot und sah beschämt zur Seite.
»Du musst nicht wegsehen«, beschwichtigte Lorn, »das ist der Lauf der Dinge. Irgendwann einmal ist jeder so weit wie du.«
Mark schwieg und hing seinen Gedanken nach, die nichts mit denen seines Vaters gemein hatten.
»Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben«, meinte Lorn. »Oder hast du sie verletzt?«
Mark schüttelte den Kopf. »Nein, habe ich nicht.«
»Dann ist doch alles in Ordnung. Möchtest du sie wiedersehen?«
»Was soll das? Ich würde sie ohnehin jeden Tag sehen.«
»So meine ich das nicht.«
»Was meinst du dann?«
»Ob du etwas für sie empfindest.«
»Ja.« Vorübergehenden Ekel.
»Gut. Dann geh zu ihr, mach mit ihr, was immer du tun möchtest. Sie ist ein hübsches Mädchen.«
»Ja, das ist sie.« Aber warum, dachte er verzweifelt, hatte der Himmel deswegen geweint? Weil er Tsam hintergangen hatte? Und wenn er das hatte, dann war entweder er falsch oder alles andere, was ihn umgab.
»Ich hoffe, das war dann alles, was dich bedrückt.«
Mark fühlte sich allein. »Ja, das war es wohl«, log er.
Lorn lächelte. »Schön. Und jetzt geh zu den anderen und vertreib dir die Zeit, es ist zu heiß zum Arbeiten.«
Die Sonne wollte eine andere sein, die Hitze wollte eine fremde sein, die Stille wollte eine Natur sein, die nichts zu sagen hatte.
Mark ging bedrückt zum Dorf und schwieg.
Ende des 7. Kapitels – Der Wind von Irgendwo geht weiter mit Kapitel 8: Jessica bei der Wahrsagerin




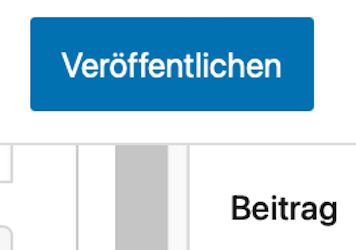
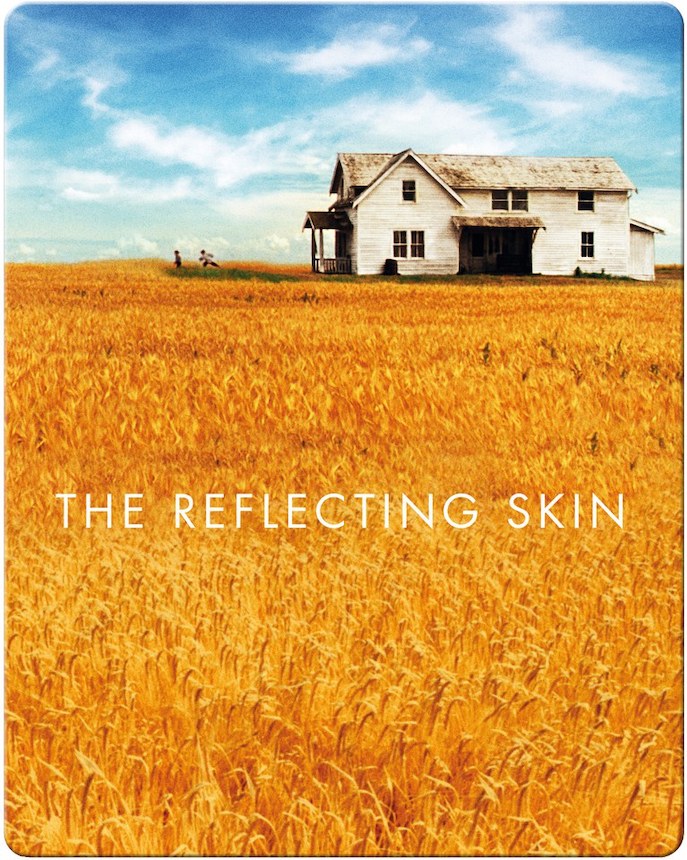


Immer wieder Sonntags …
freue ich mich auf ein neues Kapitel dieses Buches.
Es ist wieder ruhiger geworden. Die jungen Leute sind nachdenklicher, die Alten klammern sich an ihren Alltag.
Auf Sarah wirk Tirata wie ein Magnet, dem man nicht entkommen kann und will.
Ach könnte ich doch alle Zeilen aller Schriftsteller lesen. Es würde auf eine gewisse Weise einer Gerechtigkeit gleichkommen. Einer Gerechtigkeit für all die Arbeit, die im Schreiben eines Buches steckt.
Für diesen Roman habe ich mich entschieden, da er ein Stück von Oliver Koch ist – und wie man merkt, ist er ein sehr großes und gutes Stück von ihm.
Vielen Dank, Oliver. Bis nächsten Sonntag. Mal sehen, was der Wind dann bringt.
[…] TirataKapitel 4: Maraim und die FröscheKapitel 5: Die Last der SchuldKapitel 6: Der Himmel weintKapitel 7: Ein neuer TagKapitel 8: Jessica bei der WahrsagerinKapitel 9: Am FeuerKapitel 10: Beginn einer OdysseeKapitel 11: […]
[…] Der Wind von Irgendwo von Anfang an lesenErst Kapitel 7 lesen […]
[…] Ende des 6. Kapitels – Der Wind von Irgendwo geht weiter mit Kapitel 7: Ein neuer Tag […]