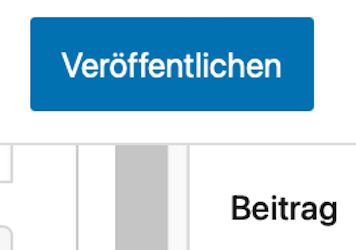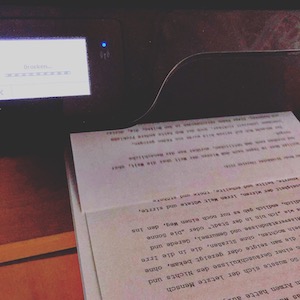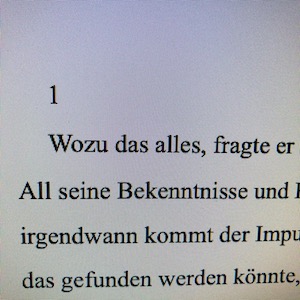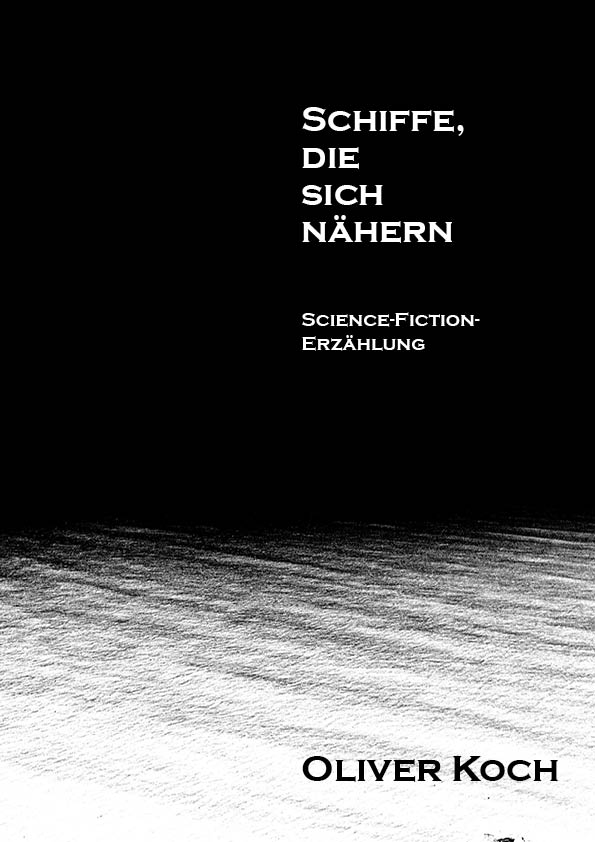Früher war mein Schreibort festgelegt: Der Schreibtisch.
Schließlich standen dort zunächst meine laute mechanische Schreibmaschine und später mein PC. Wir gut, dass diese Begrenzungen dank Laptop oder Tablet schon längst aufgehoben sind. Und wie schön, dass ich das Schreiben mit der Hand wiederentdeckt habe.
Samstagmorgen, 9 Uhr. Die Morgensonne scheint auf meinen Balkon. Seit Jahren ist er ein dicht bewachsenes Biotop mitten in der Stadt, eine kleine grüne Lunge jenseits der Balkontür.
Geschrieben habe ich bereits am Frühstückstisch bei einem großen Kaffee, in Stille eines Morgens, an dem alle noch schlafen.
Nun sitze ich in der Sonne, sie scheint morgens und abends auf meinen Balkon, da ist das Licht ohnehin am Schönsten.
Schreiben auf dem Balkon ist aber nicht so einfach bei all der Natur um mich herum, die ich sehen, ansehen, erleben möchte. Es freut mich einfach, hier zu sitzen und mir anzuschauen, was da teils in Dreierreihe wächst und blüht. Mit selbst gestehe ich wenig Platz zu, es reichen ein kleiner Tisch und ein Stuhl inmitten einer grünen Oase.
Ich bilde mir ein, dass die Texte, die ich hier schreibe, anders sind als jene, die ich nicht hier schreibe. Wer weiß.
Dass mir das Schreiben und die Natur und auf meinem Balkon guttun, ist indes unbestreitbar. Ich liebe diesen Schreibort!