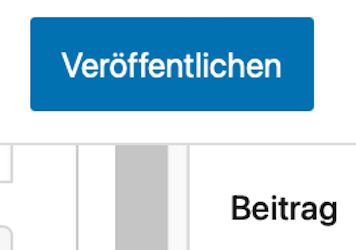Es mag banal klingen: Ich schöpfe viel Kreativität daraus, beim Schreiben nicht immer am gleichen Platz mit der gleichen Aussicht zu sitzen, sondern bewusst den Platz zu wechseln. Auch beim Denken und Überlegen kommen mir die neuen Sichtweisen zugute.
Warum, erkläre ich hier.
1. Ein anderer Blick für andere Stimmung
Der eigene Schreibtisch ist für uns Schreibenden die feste Burg, die Heimat – wie immer man selbst es nennen mag. Und das finde ich auch gut so. Doch immer wieder stelle ich fest, dass die immer gleiche Blickposition in den immer gleichen Raum auch wie eine lähmende Routine sein kann. Das merke ich immer dann, wenn ich z.B. etwas auf dem Pad in einem anderen Raum vorbereite oder bereits schreibe. Mehr unterbewusst als bewusst kommen da manchmal Ideen heraus, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und so wichtig und wunderbar Routine oder der viel gerühmte »Flow« auch ist: Routine kann auch Denkmuster verfestigen, durch die mir Ideen verloren gehen. Das habe ich schon oft erlebt. In der Küche schreibe und denke ich oftmals ungezwungener, mehr ins Blaue und aufs Geratewohl – was meinen Geschichten häufig nützt.
2. Blickposition im Raum oder Raum wechseln
Der eigene Schreibtisch ist für uns Schreibenden die feste Burg, die Heimat – wie immer man selbst es nennen mag. Und das finde ich auch gut so. Doch immer wieder stelle ich fest, dass die immer gleiche Blickposition in den immer gleichen Raum auch wie eine lähmende Routine sein kann. Das merke ich immer dann, wenn ich z.B. etwas auf dem Pad in einem anderen Raum vorbereite oder bereits schreibe. Mehr unterbewusst als bewusst kommen da manchmal Ideen heraus, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und so wichtig und wunderbar Routine oder der viel gerühmte »Flow« auch ist: Routine kann auch Denkmuster verfestigen, durch die mir Ideen verloren gehen. Das habe ich schon oft erlebt. In der Küche schreibe und denke ich oftmals ungezwungener, mehr ins Blaue und aufs Geratewohl – was meinen Geschichten häufig nützt.
3. Andere Blickwinkel, andere Textsorten
Wenn ich in meiner Küche sitze und schreibe, kommt häufig gar keine Szene dabei heraus oder eine konkrete Textstelle. Vielmehr schreibe ich »für mich«. Ich nenne diese Texte eher »Artikel«. Ich habe gar nicht den Anspruch, sie zu veröffentlichen oder zu verwenden. Fakt ist, dass ich diese Artikel an meinem Schreibtisch so gut wie nie schreibe, sondern an anderen Orten. In der Küche, auf dem Balkon, auf Reisen. Ganz bewusst halte ich sie gar nicht literarisch oder journalistisch. Mir geht es eher darum, schreibend zu denken. Damit löse ich oft Fragen, die mir beim Schreiben selbst gekommen sind und nutze sie auch als Schreibübungen: Kann ich die Dinge überhaupt angemessen in Worte fassen? Ist der Gedanke oder die Idee überhaupt ins sich logisch und sinnvoll? Und welche Sprache brauche ich, um das niederzuschreiben?
Gerade in diesem Punkt ist die veränderte Blickrichtung, -position und der Blickwinkel für mich elementar. Ich schreibe ergebnisoffen einfach drauflos. Das hat mir viele Textstellen eingebracht, aber auch neue Ideen und Gedanken zu Geschichten und Erzählungen.
Natürlich: Diese angesprochenen Punkte können unmöglich für jede/n vollständig oder komplett zutreffend sein – das ist auch ganz in Ordnung so. Wir sind Individuen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, reagieren anders, brauchen andere Dinge. Es sind vielmehr Denkanstöße, die ich zur Nachahmung dahingehend empfehle, als dass ich sage: Einfach mal ausprobieren. Vielleicht nützt es ja.