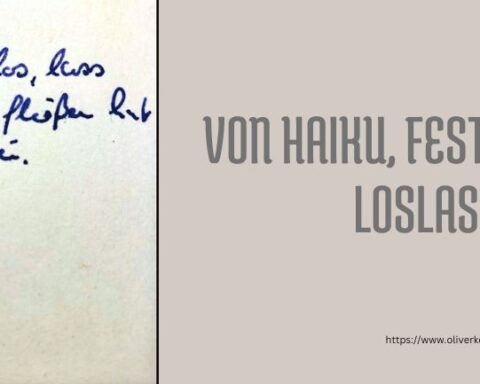Ich hatte einen Traum. Er war nicht schön. Ich verlor darin das Augenlicht, ich sah mich selbst mit geschlossenen Augen, dabei sind blinde Augen geöffnet. Ich sah nichts, orientierte mich nicht. Meine Hände waren nach vorn ausgestreckt. Wie ein Zombie tastete ich mich vor, langsam, unsicher, allem beraubt. Es war so grässlich, als sei mein Leben mit dem Ende des Augenlichts zu Ende. Oder, wieder bildhaft, als erlösche mein Leben mit dem Erlöschen des Augenlichts.
Wie ist das ohne Augenlicht? Die Welt, sie ist noch da, in all ihren Formen und Farben, aber sie verbirgt sich hinter Blindheit. Und man selbst? Alles vorbei? Ich schreckte auf. Panisch atmete ich in die Nacht hinein, in die Dunkelheit und war froh, mein Augenlicht zu haben. Es dauerte, bis ich mich wieder fing. Ich schaltete das Licht ein, blickte mich um – und war mir meiner gewiss. Als sei ich es nicht, sobald ich nichts mehr sehen könnte.
Bücher lesen? Vorbei. Filme sehen? Vorbei. Schreiben? Erledigt. Blind zu sein: Das ist ein Abschneiden von Orientierung. Dabei ist das gar nicht wahr. Wer nie sah, wird womöglich nichts vermissen.
Doch wie ist es, etwas zu verlieren? Das Augenlicht – ein schönes Wort, so wahr vor allem: Es wirft Licht in die Augen, es bringt Licht der Erkenntnis, Kenntnis der Orte, der Umgebung, der Menschen.
Aber ja, das Licht lügt ja auch. Wir sehen nichts in Infrarot, dabei ist es um uns herum. Was Insekten sehen, ist nicht weniger wahrhaftig und Teil der Welt als das, was wir mit unseren Augen sehen. Wer richtig sieht und wer nichts von beiden, ist nicht ermittelbar. Beide sehen die Welt, wie sie ist, wenn auch nur einen Ausschnitt. Was also ohne Augenlicht und ohne der Illusion der alleinigen Erkenntnis und Kenntnis? Verzweifelt wär ich. Stolperfallen, auch wenn Serien und Filme von blinden Superhelden sagen, dass man Augenlicht nicht braucht.
Blind. Als ich sehend in der Nacht um mich blickte, blieb mir fast das Herz stehen vor Schreck. Ich will nicht blind sein. Ich kann mir nicht vorstellen, mich umzugewöhnen. Der Verlust wäre so stark, dass ich ihm hinterher weinen, ja schreien würde. Seht, was ich verloren habe! Würde ich mich daran gewöhnen? Wie könnte und würde ich schreiben? Wäre es so schnell und einfach wie jetzt?
Eines wäre es jedenfalls nicht mehr: So beiläufig wie jetzt. So zwischendurch. Es wäre ein Akt der Erkenntnis, der Kenntnis, durch die größere Mühe hellsichtiger in Form und Art und Inhalt.
So sähe ich die Welt. In gewisser Hinsicht auch wieder besser als zuvor.
Blind sein heißt also alles und nichts.