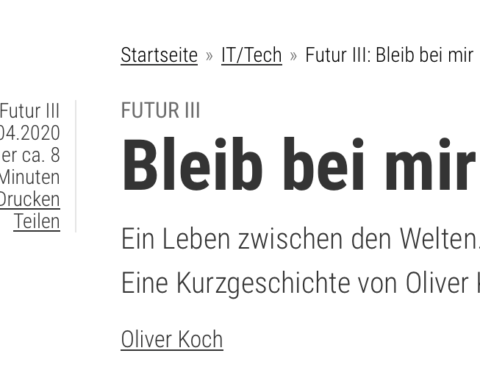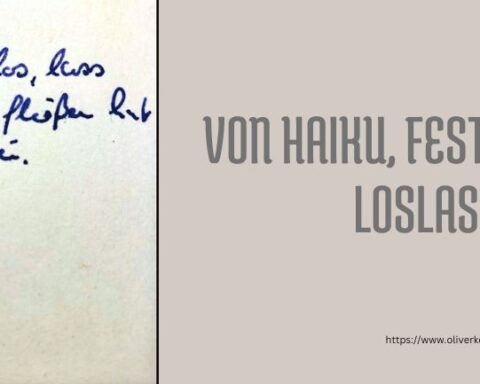Ich hatte einen besten Freund, als ich 12, 13 war. Er starb, als ich 13 war. Der Tod war damals als Konzept nicht möglich in meinem Leben, es hatte darin nichts zu suchen. Dadurch, dass es in mein Leben trat, belehrte es mich eines Besseren.
All das ist lang her. Zu vermitteln, dass der Tod von Martin damals mir heute noch nahe ginge, wäre nicht wahr.
Doch noch immer besitze ich Dinge, die mich an ihn erinnern. Damit meine ich nicht meine Geschichte, die ich damals in meinen Schock schrieb, die ich in der Klasse vorlas und die ich in meiner schönsten Schrift noch einmal für die Eltern abschrieb. Damals lernte ich, dass man derlei Texte Nachrufe nennt.
Es sind einige persönliche Dinge aus seinem Besitz.
Da ist sein Gürtel samt Schließe, die mir tatsächlich gut gefällt. So trug ich seinen Gürtel als meinen bis in meiner 40er hinein. Ich trüge ihn heute noch, würde er mir noch passen. Vielleicht wird es wieder so sein, wer weiß.
An der Türklinke meines Arbeitszimmers baumelt seit geraumer Zeit ein schmuckloser Beutel. Außenstehende dürften kaum mehr darin erkennen als einen hässlichen, schmutzigen Stofffetzen. Natürlich ist er das – meine Erinnerung an seinen Zweck macht ihn nicht hübsch, auch seine Geschichte muss man von der Optik lösen. Ja, der Beutel ist alt, hässlich und sogar schmutzig.
Martin und ich machten anno 83/84 die Welt mit Blasrohren unsicher, die wir aus Aluminumröhren gesägt hatten. Durch sie schossen wir harte, ungekochte Erbsen. Wir nahmen sie in den Mund, zielten und spuckten sie durch unsere Rohre. Neben der Geschwindigkeit war auch die Wucht des Treffer beachtlich. Unsere zeitweise Vorliebe für vorbeifahrende Autos währte nur kurz. Die Fahrer, die uns hinterherrannten, waren uns einfach zu gefährlich. Dass es auch nicht richtig war, mit Erbsen auf Autos zu schießen, kam uns erst im Anschluss an unsere Vorsicht.
In dem alten Beutel trug Martin seine Erbsen mit sich.
Leer ist dieser Beutel heute nicht. Ich bewahre sein Taschenmesser darin auf, das er stets bei sich hatte.
Heute höre ich es täglich, wenn es gegen meine Tür rumpelt.
Mich verbindet kein Verlustschmerz damit, ich werde nicht emotional. Aber ja, manchmal denke ich an ihn.Tatsächlich habe ich mich nie gefragt, wie unser beider Leben nun wären, wenn er nicht gestorben wäre. Es spielt keine Rolle.
Da ist vielmehr eine Selbstverständlichkeit, Martins Dinge zu besitzen und zu wissen, woher sie kamen und wozu sie dienten. Eine Selbstverständlichkeit, die es mir unmöglich macht, mich davon je zu trennen. Weil sie, wie genau auch immer, zu mir gehören. Diese Selbstverständlichkeit ist gut, gut in jeder Lesart. Alles andere ist nicht richtig.
Wäre der Beutel nicht mehr da, trüge ich womöglich das Taschenmesser daraus immer bei mir, kann sein, dass sich die Weise ändert, wie ich mich erinnern werde, aber dieses Gefühl, dass es richtig ist, die Erinnerung als Teil von mir zu sehen, bleibt unumstößlich.
Vielleicht sind dies die Dinge und Gewohnheiten,die uns ausmachen – und ebenso deren Fehlen. Das Konzept des Todes, das damals nicht zu mir gehörte, tut dies nun selbstverständlich. Und auch wenn wir gern den Tod als das Gegenteil des Lebens sehen, so zeigen doch gerade diese Dinge, dass das so nicht stimmen kann. Denn im Erinnern und in Denken sind diese Grenzen fließend – tröstlich.